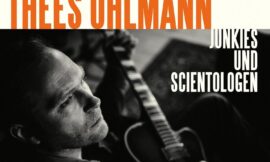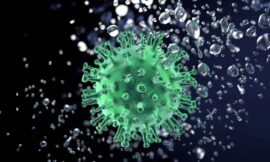Viele deutsche Philosophen müssen wohl auf die eine oder andere Art durch ihre Hölderlin-Phase. Er gilt als eine besondere Ausprägung des Ideals des Dichters und Denkers. Friedrich Hölderlin (1770-1843) ist neben Hegel (1770-1831) und Schelling (1775-1854) einer der prägenden Köpfe des sogenannten Deutschen Idealismus. Hegel, Hölderlin und der jüngere Schelling teilten im Tübinger Stift ein Zimmer. Es ist wohl die einflussreichste Wohngemeinschaft der Philosophiegeschichte, die die Welt des Denkens nachhaltig verändert hat. Wer wie ich in Tübingen studiert hat, kommt an Hölder, wie seine Freunde ihn nannten und deshalb ich auch, nicht vorbei. Nicht wenige Philosophiehistoriker sehen in Hölderlin nicht nur den Dichter, sondern auch den entscheidenden Autor des wegweisenden Ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus, dem sich im Grunde auch PzZ verpflichtet weiß.1
Sei’s wie es sei. Mir scheint, Hölderlin muss man lesen und lieben, weil … er eben Hölderlin ist,2 und natürlich weil er etwas zur Sprache bringt, das uns die Welt anders zu sehen erlaubt. Seine Oden aus der Frankfurter Zeit gehören zu dem Schönsten was in deutscher Sprache geschrieben wurde. Und schön, das heißt im Deutschen Idealismus auch immer wahr. An die Parzen ragt hier in vielem heraus. Marcel Reich-Ranicki hat es in seinen 1.000 Deutsche Gedichte unter dem Titel Den Göttern gleich gefeiert: nomen est omen.
An die Parzen
Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
Daß williger mein Herz, vom süßen
Spiele gesättiget, dann mir sterbe.
Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;
Doch ist mir einst das Heil’ge, das am
Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen,
Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel
Mich nicht hinab geleitet; Einmal
Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht.
An die Parzen vermögen wir heute nicht mehr zu glauben. Wir haben uns von ihnen abgeschnitten – und damit von uns. Dass Klotho den Lebensfaden spinnt, scheint uns so spinnert wie dass eine Zuteilerin, Lachesis eben, ihn abmisst und Atropos über das Unabwendbare schließlich die Entscheidung fällt und ihn durchtrennt. Das Unabwendbare, Ἄτροπος, ist kein Teil unseres Selbstverständnisses mehr. Unser Leben führen wir gerne verdüstert – wir wollen das Ende nicht sehen und können es meist nicht zulassen: es soll immer so weitergehen. Wir erfahren uns im Aufstand gegen unser eigenes Dasein. Wir leben nicht aus dem Unabwendbaren.
Aber: alle Menschen sind sterblich.3 Ich, aber auch Sie und sogar Du. Unser Leben ist befristet und in seiner Frist liegt aller Sinn, dem wir ihm zu geben vermögen. Ein endloses Dasein – das wir zu wünschen scheinen – ließe unser Handeln orientierungslos. Wer mit der Befristung seines Lebens nicht zu leben vermag, der wird jedenfalls unglücklich verzweifeln.
„Viel zu früh…“
Nun kann uns das Ende zu früh ereilen. Das, was wir sind, konnten wir dann nicht sein. Der Mensch weiß als vernünftiges Wesen um seine Sterblichkeit. Vernunft und das Wissen um sich selbst aber bilden wir aus und wir brauchen dafür die rechte Gesellschaft und nicht zuletzt Zeit. Das steht nicht in unserer Macht. Deshalb müssen wir hoffen, dass uns von den Parzen, den „Gewaltigen“, der Sommer zum Aufblühen gewährt wird und der Herbst, um das Reifgewordene ernten und genießen zu können.
Hölderlin spricht von „einem“ Sommer und „einem“ Herbst „zu reifem Gesange“. Um das zu werden, was man eigentlich ist,4 nämlich das zu sein, was den Menschen ausmacht, muss er sich „entwickeln“, „groß werden“ und zu sich selbst kommen – vom „wesentlich werden“ dichtete Angelus Silenius5 – nämlich eine Person werden, die um sich weiß. Personen sind sprechende Wesen (ζῷον λόγον ἔχον). Sie finden sich im Gespräch mit anderen Personen und im Sprechen mit anderen, vermögen sie sich im Anderen zu erkennen: ich bin derjenige, zu denen die anderen „Ichs“ „Du“ sagen.
Hölderlin hat die grundlegende Rolle der Sprache für die „Mensch-Werdung“ erkannt: Der Mensch erhebt sich ins Geistige – so heißt es z.B. in der Friedensfeier – „seit ein Gespräch wir sind und hören von einander“. Der Dichter „verdichtet“ die gemeinsame Welt im sprachlichen Ausdruck. Er stiftet, wie Hölderlin später sagen wird, das Bleibende.6 Der Dichter verbindet das mit „reifem Gesang“, nämlich damit, dass „mir einst das Heil’ge, das am / Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen“ sein wird.
Der Gesang, von dem Hölderlin spricht, ist eine Form des Dasein, das unser Leben als Ganzes prägt und durchklingt. Das Leben, das gut geführte, ist etwas, das zu einem wohlgeformten Ganzen gedichtet wird. Es wird in unseren Tagen deshalb viel von Narrativen gesprochen: das Leben, das als gelungen und glücklich erlebt wird, hat eine Lebensgeschichte, die von ihrem Helden geformt und als ein sinnvolles Ganzes erlebt wird, in dem er sich wiedererkennt. Für die antike Ethik hieß das, dass ein Leben erst von seinem Ende bewertet werden kann. Aristoteles hat in seiner Nikomachischen Ethik die Paradoxien dieser durchaus naheliegenden Vorstellung diskutiert.7 Sie krankt für Aristoteles vor allem daran, dass Glück, Eudaimonie (εὐδαιμονία), als eine Tätigkeit verstanden werden muss, nämlich als Wirken eines guten Geistes, eu daimon (εὐδαίμων), der das Leben bestimmt. Wenn Hölderlin von „Gedicht“ oder „Gesang“ spricht, dann meint er nicht ein abgeschlossenes Ganzes als das sich das Leben zeigt, sondern ein Durchformtsein und ein harmonisches Gestimmtsein des Lebens. Das Leben hat nicht die Form einer Zielerreichung, nämlich z.B. der Verfertigung eines Kunstwerks wie dem perfekten Gedicht. Ziele machen unglücklich, vor allem große. Je höher der Gipfel ist, den man erklommen hat, desto enttäuschender ist der Abstieg ins dann sinnlose Tal. Wer auf dem Gipfel angekommen ist, den er sich zum Ziel seines Lebens gemacht hat, der hat einen kurzen Augenblick der Erfüllung und sieht von dort aus aber nur noch ins Leere und muss sich schnell neue Ziele suchen – ad infinitum.8 Ziele, vor allem große Ziele, lassen, den der sie erreicht, orientierungslos zurück.
Nicht dass wir den „reifen Gesang“ nicht ein zweites und drittes mal singen und hören dürften, d.h. uns viele Jahre gelungenen Lebens geschenkt sein können. Wir dürfen uns glücklich heißen, wenn uns das gewährt wird. Die Schönheit des Gesangs muss nicht zwangsläufig hier und jetzt verstummen. Aber sie muss es irgendwann. Das „Mach’s noch einmal“ kann nicht zum Lebenssinn werden. Die Serie gibt keinen Sinn. Sie braucht etwas, das jenseits der Wiederholung Sinn macht. Das Bedeutsame schafft sich nicht aus der Wiederholung des Sinnlosen. (Noch) Vieles erleben zu wollen ist natürlich durchaus wünschenswert. Aber das Viele, das immer noch aussteht, darf das Leben nicht bestimmen. Das macht es auf immer unvollständig.
Die Welt des Glücklichen
Die Welt des Glücklichen, des vom „Gesang“ gestimmten, ist eine andere als die des sprachlos Unglücklichen.9 Wer liebt – so wird Hölderlin in der ebenfalls aus der Frankfurter Zeit stammenden Ode Menschenbeifall sagen10 – der ist verändert und dem ist die Welt eine andere geworden. Der Schlafende teilt keine Welt, er lebt in einer, die nicht die seine ist und ihm bewusstlos zustößt. Ob er aufwacht oder stirbt entscheidet nicht er.

Das Leben muss, wenn es gelingen soll, eine Gestalt annehmen. Und jede Form ist begrenzt. Das Leben versteht sich als ein Inneres, das sich vom Äußeren abgrenzt, also als etwas, das ein Ende hat. Dem Ende zu gedenken ist keine willfährige Theodizee. Dem Leben kann nur Sinn gegeben werden, wenn es eine Form annimmt, die ihm vom dem Wesen, das es in seinem Sein um dieses geht, selbst gegeben werden muss. Der Mensch versteht sich als das Wesen, dem ein „göttlich Recht“ zukommt. Wer dem nicht gerecht zu werden versteht, der vergeht sich an ihm und darf auch auf kein ruhiges Dasein in einer anderen Welt hoffen. Hölderlin nennt sie „Orkus“ und „Schattenwelt“ im Anklang an Homers Unterwelt. Wir nennen dieses unbefriedigte Leben und vor allem den ohnmächtigen Rückblick darauf, der nichts mehr an seinem Verwirktsein zu ändern vermag, die Hölle.
Folge nicht Grund
Der Gesang dient freilich nicht dem Sterben. So wie die Begegnung mit dem Guten uns Freude macht und Lust spendet, so suchen wir es doch nicht wegen der Lust. Das Gute ist nicht wegen der Freude, die wir an ihm haben, zu erstreben – wir würden dann gar nicht das Gute, sondern eben die Lust suchen. Dichtung ist nicht dazu da, uns in die Unterwelt zu geleiten: „wenn auch mein Saitenspiel / Mich nicht hinab geleitet“. Sie erhebt aber – wie die Philosophie – den Geist auf das Geistige, das „Heilige“. Der Mensch ek-istiert, er geht über sich hinaus, betrachtet sich von außen („oben“) und kann so auf sich zurückkommen. Dieses Hinausgehen und Zurückkommen, die Reflektion aufs eigene Sein, ist ein Grundmotiv des Deutschen Idealismus.
Auch die Philosophie wurde lange Zeit als die Kunst verstanden, ins Sterben einzuüben.11 Das ist sicher falsch pointiert oder doch zumindest höchst missverständlich. Der Ethik geht es ums Leben, ums gelungene Leben, zu dem freilich das Sterben gehört. Der Tod als Ende des Lebens gehört nicht mehr zum Leben. Er ist das gänzlich Andere, zu dem sich das Leben verhalten muss. Wir müssen uns lebend darauf verstehen, dass es ihn gibt und unser Leben endet. Wer das „kann“ und sein Leben als vernünftiges Wesen zu führen weiß, der wird – so Hölderlin – „gesättigt“ am eigenen Wesen sich „williger“ ins Unabwendbare fügen.
Dem entspricht die erstaunliche Ruhe von tiefgläubigen Menschen, mit der sie ihr Leben führen und die sie ihrem Tod entgegenbringen. Die Begegnung mit dem Göttlichen durchstrahlt ihr Leben. Für den Dichter Hölderlin ist es die Erfahrung des Schönen: „Einmal / Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht“ – alles, was kommt, kommt aus dieser den Göttern zugesprochenen, zufriedenen Ruhe des Daseins. Dem Menschen, dem es in seinem Leben um seine Lebensführung geht, erfährt in der Begegnung mit dem Schönen, dass er tatsächlich selbstbestimmt zu leben und sich darin tatsächlich zu verwirklichen vermag. Das Göttliche des eigenen Daseins geht ihnen im Schönen auf: „An das Göttliche glauben, / Die allein, die es selber sind“ wird es bei Hölderlin in einer anderen Ode aus der Frankfurter Zeit heißen.12
Zu spät
Das Ende – auch das wissen wir – kann ein spätes, zu spätes und allzu schmerzliches sein. Der Tod begegnet dem Menschen im Sterben. Er verendet nicht einfach oder hört plötzlich auf zu sein. Was den meisten Modernen als glücklicher Tod gilt, nämlich der „plötzliche und unerwartete“, von dem wir seit 2021 so oft hören müssen, war und ist vielen Christen noch immer, vor allem den katholischen, etwas erschreckendes: Sterben ist etwas, das wir durchleben und dass wir in gewissem Sinne tun. Als Menschen sterben wir wie wir leben, nämlich bewusst. Wir können verängstigt sein und werden so sterben. Oder zuversichtlich leben und selbstbestimmt und so dem Tod begegnen. Wir können am purem Leben als Weiterleben hängen und uns zu diesem Zwecke an allerlei Geräte und Schläuche anschließen lassen, bittere Arzneien schlucken und von Therapie zu Therapie stolpern; oder wir entziehen uns der Knechtschaft des Lebens und verhalten uns frei zu dem, was wir sind und sein wollen: geistige Wesen. Wo ist der Gewinn, wenn das Leben zum Überleben und zur Körperpflege des mehr und mehr geschwächten und verdüsterten Dasein wird? Wer sich vor allem als Körper versteht, macht sich dazu. Im Sterben verhalten wir uns wie im Leben zu uns selbst. Das ist ein sprachliches Geschehen im Gespräch mit anderen. Wir leben anders als andere Lebewesen, indem wir um dieses Leben und sein Ende wissen. Wir haben es und können es aufhören.
Wenn wir unser Leben nicht mehr glauben in der uns eigenen Weise führen zu können und uns das Leben entgleitet, dann ist sein Ende kein Schaden, vielmehr ein Gewinn. Wir verlieren das qualvolle Joch, das uns am Leben verzweifeln lässt. Es ist der erlebte (!) Zustand, seine Selbstbestimmung zu verlieren und seinem „göttlichem Recht“ nicht mehr gerecht zu werden. Es ist ein Jammer, leben zu müssen, ohne sein Leben führen zu können. Man muss nicht so weit gehen, wie Friedrich der Zweite von Preußen (1712-1786), von dem in seinen Gesprächen mit Catt folgender Reim überliefert ist: „Hat man alles verloren, ohne Hoffnung und Licht, / wird das Leben zur Schande, der Tod zur Pflicht.“13 Aber wer sein Leben führen will – und das heißt immer gut führen will –, der muss es aufzugeben bereit sein. Nur so sind wir Sterblichen den Göttern gleich.
1Es liegt nur als Fragment und in der Handschrift Hegels vor. Vieles deutet allerdings darauf hin, dass es ursprünglich von Hölderlin entworfen wurde und dann mit den Freunden Hegel und Schelling diskutiert und in deren eigenen Schriften konkretisiert wurde.
2Aber es gibt, man mag es kaum glauben, nicht nur Bewunderer Hölderlins. Nicht wenigen ist er zu schwulstig und zu schwierig, zu dröhnend und deutschtümelnd, zu versponnen und verschnörkelt. Dem glühenden Befürworter der Französischen Revolution wird vorgeworfen, in einer anachronistischen Griechenverehrung einem Jargon der Tiefsinnigkeit und Hochgeistigkeit zu huldigen. Es sind vor allem die Hymnen des „mittleren“ Hölderlin, die den einen als dichterische Offenbarung gelten und von anderen als völlig überschätztes Geistigkeitsgetue beurteilt werden. Auch gibt es da wiedermal einen Kontaktschuldvorwurf: Deutschtümler nämlich und konservative „Revolutionäre“ haben den Vertreter einer Republik der Freiheit, der Hölderlin zeitlebens war, für sich vereinnahmt und seine sogenannten „patriotischen Gedichte“ wurden auch im Nationalsozialismus gerne und völlig verblödet für die eigene Sache missbraucht. Wer von Heidegger noch dunkler gedacht wird als er eh schon zu sein scheint, der darf nicht damit rechnen, unter der Kultur der demonstrativen Wokeness selbstgerechter Medienschaffenden besonders beliebt zu sein.
3Das ist nicht nur eine in der Logik gern genutzte Prämisse zur Erläuterung des Syllogismus: Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch. Also ist Sokrates sterblich. Sie ist auch das Vorausgeschickte unseres Lebens.
4Nietzsche, der Anti-Teleologe, sprach in seinem späten Ecce Homo spöttelnd davon Wie man wird, was man ist – so jedenfalls sein Untertitel.
5Mensch, werde wesentlich heißt es bei Johannes Scheffler (1624-1677) alias Angelus Silesius in seinem Gedicht Zufall und Wesen.
6Mit „Was bleibet aber, stiften die Dichter“ lässt Hölderlin eines seiner berühmtesten Gedichte Andenken enden, das namhafte Interpreten zu kontroversen Interpretationen motiviert hat. Gadamer z.B. kritisiert die Interpretation Heideggers, dem er sonst mit größter Hochachtung begegnet, als eigensinnig und von den eigenen philosophischen Ambitionen geprägt; und er schlägt selbst Lesart vor, die sich wesentlich stärker an den beschriebenen Phänomenen orientiert.
7Der Mensch wäre z.B. erst dann glücklich, wenn er gestorben ist (EN I 11). Wenn die dem Solon zugeschriebene Vorstellung aber nur so viel sagen will, dass man jemanden erst dann glücklich nennen will, wenn er „allem Übel und Ungemach enthoben ist“, dann würde der Tod als „Abrechnungszeitpunkt“ nicht wirklich genügen, denn das Schicksal seiner Kinder und Enkel müssten auf seine „Glücksgeschichte“ noch angerechnet werden.
8Als Michael Schuhmacher mit seinem 41. Grand Prix Sieg er zu seinem großen Idol Ayrton Senna aufschloss, der ebenfalls 41 Siege einfuhr, brach er während der Pressekonferenz hilflos in einen minutenlangen Weinkrampf aus. Alles erreicht und nun … der 42. und 43. und 44. und immer so weiter?
9Nur der Mensch hat eine Welt in der er lebt. Er ist das Welt-Wesen. Er findet sich in ihr. Tiere leben in einer Umgebung, sind Teil einer Umwelt, von der sie nichts wissen: sie nehmen Dinge in ihr wahr, sie selbst aber nicht und verstehen sich auch nicht aus ihr. Dazu müssten sie sprechen.
10Menschenbeifall
Ist nicht heilig mein Herz, schöneren Lebens voll,
Seit ich liebe? Warum achtet ihr mich mehr,
Da ich stolzer und wilder,
Wortereicher und leerer war?
Ach, der Menge gefällt, was auf dem Marktplatz taugt,
Und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen;
An das Göttliche glauben,
Die allein, die es selber sind.
11„Philosophie heißt sterben lernen“ so der Titel eines Essays von Michel de Montaigne (1533-1692). Wir sind – so Montaigne – „alle Tage zum Tode unterwegs“ bis wir endlich bei ihm anlangen. Platon lässt „seinen“ Sokrates an seinem Sterbetag sagen, der Philosoph strebe tatsächlich „nach nichts anderem als nur zu sterben und tot zu sein“ (ὅτι οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀποθνῄσκειν τε καὶ τεθνάναι: Phaidon 63e). Natürlich ist damit der Philosoph nicht hinreichend beschrieben: Philosophie lässt sich wohl nicht auf Selbstmord reduzieren. Allenfalls auf einen Freitod, der auf einer freien und vernünftigen Entscheidung beruht und deshalb das ausgebildete Vermögen des logon didonai voraussetzt, sich frei und vernünftig zu orientieren und sich auf sich und die Welt zu verstehen. Wie immer bei Platon müssen wir genau hinhören und das Gesagte aus dem Gesprächs- und Fragekontext verstehen. Platon lässt Sokrates von denjenigen sprechen, „die sich auf die rechte Art mit Philosophie befassen, ohne dass es freilich die andern merken“. Simmias, einer seiner Gesprächspartner während seiner letzten Stunden im Gefängnis, gibt darauf zu bedenken, dass die Leute, „die Vielen“, dem wohl zustimmen würden: die Philosophen legen es geradezu darauf an, zu Tode zu kommen und verdienten es wohl auch, dass man ihnen dabei – mittels Todesurteilen – zu Hilfe käme. Sokrates will nicht bestreiten, dass es den Philosophen auf besondere Weise zukomme, zu sterben, sie nämlich „würdig“ seien (ἄξιοί εἰσιν) den Tod zu erleiden. Allerdings hat er Zweifel, dass „die Vielen“ wüssten, worin die Würdigkeit bestehe.
12So die letzten Zeilen aus Menschenbeifall cf. Fussnote 10.
13Friedrich der Große, Gespräche mit Catt, S. 280. Wir hören hier die wenig erbauliche Beschwörung des verzweifelten Kriegsherrn, der in der furchtbar verlustreich geführten Schlacht bei Kolin () seinen Soldaten zugerufen haben soll „Kerls, wollt’ ihr ewig leben“?