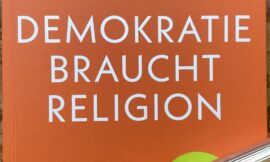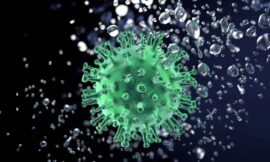Ist der Wille frei oder determiniert? Diese Frage dominiert die philosophische Auseinandersetzung über den Willen[1]. Damit stellt sich zugleich die Frage nach „der Stellung der Menschen im Universum“. Aber sie lässt mit der Determinismus-Debatte wesentliche Aspekte philosophisch unhinterfragt. Das führt zu einer Deformation des Willensbegriffs. Dies ist der Versuch einer Verteidigung der Willensfreiheit gegen die Einwürfe des Determinismus. Drei Thesen stehen im Zentrum der Untersuchung:
- Die Argumente für einen universalen Determinismus sind unplausibel; insbesondere berufen sich die Verfechter des Determinismus zu unrecht auf die Naturwissenschaften.
- Das Phänomen des Willens ist in der aktuellen Diskussion häufig unzureichend beschrieben; insbesondere dort, wo mathematisch naturwissenschaftliche Gedanken-Modelle im Zentrum der Analyse stehen.
- Die universalen Thesen des Determinismus[2] lassen sich nicht reflexiv auf die eigene philosophische Praxis anwenden; insbesondere ist das Argumentieren für eine deterministische Position nicht frei von performativen Widersprüchen.
Zur Plausibilität des Determinismus

Die Plausibilität des Determinismus wird häufig durch Beispiele verdeutlicht. John Searle skizziert im Zusammenhang mit der Debatte um die Möglichkeit des freien Willens folgende exemplarische Situation: Von einer geologischen Erklärung von Erdbeben wird erwartet, dass geologische Gesetze unter spezifischen Randbedingungen belegen, dass sich ein Erdbeben mit Notwendigkeit ereignen musste.
Dies ist zwar die exemplarische Skizze einer wissenschaftlichen Erklärung; sie enthält aber keinen Hinweis auf den Totalitätsanspruch solcher Erklärungen. Im Gegenteil – hieran lässt sich der Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Haltung und einer szientistischen Position verdeutlichen[3]. Dies zeigt eine leichte Abwandlung des Beispiels. Angenommen, eine Ursache für das lokale Erdbeben ist ein in der Nähe durchgeführtes Fracking. Ein Geologe würde dieses Fracking ebenfalls geologisch beschreiben und so in seine Erklärung einbeziehen. Zugleich würde er nicht versuchen, die politischen Umstände, die das Fracking ermöglicht haben, oder das planerische Vorgehen der Ingenieure geologisch zu erklären. Er wird „menschliche Faktoren“ nur insoweit ernsthaft berücksichtigen, als sie sich geologisch auswirken. Da ein Geologe als Geologe nicht über „menschliche Faktoren“ sprechen kann, wird er als seriöser Geologe dazu schweigen. Dasselbe gilt für Physiker, die mit ihren physikalischen Formeln (z.B. in Schrödinger-Gleichungen) neben dem primären Gegenstand ihres Experiments nicht auch den Experimentator in gleicher Weise zu erfassen versuchen. Auch Neurowissenschaftler kennen in der Regel die Grenzen Ihres wissenschaftlichen Erklärungsansatzes.
Forschungsprogramm statt Ontologie
Das Beispiel zeigt, dass man sich für die Plausibilisierung eines universalen Determinismus nicht auf die naturwissenschaftliche Praxis berufen kann. Naturwissenschaftler kennen und beachten in der Regel die Grenzen ihres Erklärungsanspruchs.
Gleichwohl dehnen sich diese Grenzen immer weiter aus und es ist kaum zu sagen, ob diese Ausdehnung an ein prinzipielles Ende gelangt. Liegt in diesem Forscherdrang und der wissenschaftlichen Expansion nicht doch ein Totalitätsanspruch? Diese Frage ist zu bejahen. Aber die Bestätigung liefert kein Argument für einen Determinismus. Der Totalitätsanspruch naturwissenschaftlicher Erklärung ist hier als Maxime eines Forschungsprogramms zu verstehen und nicht als ontologische Aussage. Er besagt nicht, dass alle Ereignisse in der Welt ontologisch so verfasst sind, dass sie einer strikten Kausalität unterworfen sind. Es besagt vielmehr, dass ein beliebiges Ereignis, insofern es naturwissenschaftlich erfasst werden soll, als determiniert angesehen werden muss. Ohne die Annahme von Determiniertheit oder – allgemeiner formuliert – von naturwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeit[4] hat Naturwissenschaft keine Operationsbasis.
Diese Differenz verkennt ein ontologisch verstandener Determinismus. Zugleich verdeutlicht die Unterscheidung, dass sich der Determinismus in seinem ontologischen Totalitätsanspruch nicht auf die Naturwissenschaften berufen kann.
Die naturwissenschaftliche Annahme allgemeiner Determiniertheit ist Teil eines grundlegenden Perspektivismus der Naturwissenschaften. Naturwissenschaftler „blicken“ aus einer bestimmten Perspektive auf „die Welt“. Gerade diejenigen Aspekte, die sich hier als solche unumstößlicher Allgemeinheit zeigen, sind nicht ontologische Aspekte der „Welt an sich“, sondern konstitutive Elemente der naturwissenschaftlichen Perspektive. Wenn anzunehmen ist, dass Naturwissenschaften „nur“ eine Perspektive des „Weltzugangs“ verkörpern, ist auch zu erwarten, dass es grundlegend andere Perspektiven gibt. Auch das verkennt ein ontologisch verstandener Determinismus. Allerdings muss zugestanden werden, dass die erwähnten Perspektiven Perspektiven auf dasselbe – die eine Welt, in der wir handeln und forschen – sind, und sie deshalb philosophisch in ihrem Zusammenhang verstanden werden müssen.
Der Perspektivismus der Naturwissenschaften ist unter anderem für deren Erfolg verantwortlich. Er zeigt sich nicht nur in der Forschungshaltung, sondern auch in der Theoriebildung. Die Naturwissenschaften, und speziell die Physik, haben in einigen revolutionären Erkenntnisschritten die Relativität ihrer Forschungsperspektive erkannt und in ihren theoretischen Apparat eingebaut – angefangen von Newtons Zurückweisung eines absoluten Raumes, über Einsteins spezielle und allgemeine Relativitätstheorie bis hin zur Kopenhagener Deutung der Quantenphysik, nach der das Wellen- oder Teilchenverhalten mikroskopischer Objekte von der Art ihrer experimentellen Beobachtung abhängen.
Diese in die naturwissenschaftliche Theorie eingebaute Relativität verkennen manche Vertreter des Determinismus. So führen sie u.a. die kopernikanische Wende als Beispiel für die trügerische Unzuverlässigkeit der persönlichen Erfahrungen und die Überlegenheit wissenschaftlicher Erfahrung an. Kopernikus hätte demnach mit dem Postulat des heliozentrischen Weltbildes bewiesen, dass die unmittelbare geozentrische Haltung naiv und falsch ist. Tatsächlich hat Newton gelehrt, dass es keinen absoluten Raum gibt, sondern jede Bewegung physikalischer Körper relativ zu einem disponiblen Koordinatensystem beschrieben werden muss. Den Ursprung des Koordinatensystems auf die Erde zu legen, ist nicht falsch, sondern nur unökonomisch im Sinne einer mathematischen Theoriebildung. Falsch ist allein der Anspruch auf Absolutheit dieses geozentrischen Standpunkts. Im gleichen Maße falsch ist jedoch die Absolutheit des heliozentrischen Standpunktes. Anders gesagt: Die geozentrische Erfahrung der Bewegung der Himmelskörper um die Erde ist nicht täuschend oder unzuverlässig, wie es manche Szientisten zugunsten einer naturwissenschaftlichen Erkenntnis darstellen. Falsch ist allein der Anspruch auf Absolutheit dieses und jedes anderen Standpunktes.
Die Tendenz, die Relativität der Beobachtungssituation in die naturwissenschaftliche Theoriebildung zu integrieren, hat sich in der modernen Physik bis hin zur Quantenmechanik verschärft. Es wird zwar von Deterministen allgemein zugestanden, dass mit der Quantenphysik das Prinzip des Zufalls in die Grundlagen der Naturwissenschaften Einzug gehalten hat, gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass die Annahme kausaler Notwendigkeit makroskopisch immer noch in Geltung ist. Dies ist freilich ein gefährliches Argument, verlässt man damit doch die Höhen abstrakter Argumentation und einfacher Gedankenexperimente (wie diejenigen von Harry Frankfurt) und betritt die weite Ebene konkreter wissenschaftlicher Forschung. Es genügt dann nicht länger zu zeigen, dass der Determinismus im Prinzip gilt – denn dass dies nicht so ist, wird zugestanden. Nun muss der Anspruch der Determiniertheit von Überlegungs- und Entscheidungsprozessen theoretisch eingelöst werden. Es gilt zu zeigen, dass das Ergebnis solcher Überlegungs- und Entscheidungsprozesse jederzeit mathematisch genau vorhersagbar ist, ähnlich wie die Flugbahn eines Apfels. Solche mathematischen Theorien im Feld des Bewusstsein sind nicht in Sicht, und sind womöglich auf Grund der reflexiven Struktur des Bewusstsein prinzipiell nicht zu finden. Oder ist es vorstellbar, dass eine naturwissenschaftliche Theorie des Bewusstseins auch sich selbst und ihre philosophische Reflexion mathematisch genau rekonstruieren kann?
Die Behauptung, dass der Determinismus im Bereich von Bewusstsein und Wille gilt, ist durch keine konkreten naturwissenschaftlichen Kausalgesetze belegt.
Ein letzter, aber entscheidender Punkt, in dem Determinismus und naturwissenschaftliche Haltung voneinander abweichen, ist der Primat der Erfahrung gegenüber theoretischen Aussagen über die Natur. Naturwissenschaftliche Theoreme sind Forschungshypothesen, die durch Experiment und Erfahrung bestätigt oder auch falsifiziert werden können. Sie können wegen ihres Überschusses an Universalität nicht in einem strengen Sinne verifiziert werden, und sind immer wieder in der Geschichte der Naturwissenschaften relativiert und überwunden worden. Diese Haltung macht den großen Erfolg der modernen Naturwissenschaften aus; sie besagt aber zugleich, dass es unangemessen ist, im Namen der Naturwissenschaften theoretische Postulate über gemachte Erfahrung zu stellen. Dies gibt auch für das radikale Postulat des Determinismus und dessen Negation der Erfahrung von Willensfreiheit.
Umgekehrt liegt darin die Aufgabe, die unterschiedlichen Erfahrungen von Willensfreiheit auf der einen Seite und von naturwissenschaftlicher Forschung auf der anderen Seite in ein kohärentes philosophisches Theoriegebäude zu integrieren. Hierfür muss zunächst der Status von Erfahrung im Kontext von Willensfreiheit geklärt werden. Wie steht es um Inhalt und Evidenz dieser Erfahrung? – Die Frage führt zu den anderen Aspekten, die hier untersucht werden sollen: der Angemessenheit des Verständnisses von Willen, wie es in der aktuellen philosophischen Diskussion verbreitet ist; und der reflexiven Widerspruchsfreiheit einer deterministischen Position.
Das Ungenügen des Willens-Begriffs
Der Blick auf das volle Phänomen der Willensfreiheit wird in der gegenwärtigen philosophischen Debatte durch drei Besonderheiten verstellt:
- Meist steht der Aspekt der Entscheidung im Zentrum; der vielschichtige Prozess der Überlegung und dessen Rationalitätsaspekte bleiben unterbelichtet.
- Wesentliche Aspekte der Willensfreiheit werden entlang mathematischer Modelle beschrieben und analysiert.
- Die Diskussion um die Willensfreiheit wird von Gedankenexperimenten dominiert.
Gedankenexperimente sind von zweifelhaftem Nutzen. Nicht selten besteht der Nutzen darin, dass durch den Nachweis der Unangemessenheit des Gedankenexperiments derjenige Aspekt des Phänomens deutlicher hervortritt, dem das Gedankenexperiment nicht genügt.
„Play it, again“
Dies könnte auch für das bekannte „Replay“ Gedankenexperiment gelten. Es besagt: Wenn man das Weltgeschehen auf eine Zeit t kurz vor einer Entscheidung zurückstellt, dann sind scheinbar durch den erneuten Ablauf des Geschehens ab diesem Zeitpunkt nur zwei Szenarien denkbar. (i) Als Determinist muss man annehmen, dass die Entscheidung aufgrund kausaler Notwendigkeit genau so ausfällt, wie beim ersten Mal. (ii) Als Libertarier muss man annehmen, dass die Entscheidung anders als beim ersten Mal ausfallen kann. Sie wäre nicht kausal determiniert und damit durch Zufall bestimmt. Die Zufälligkeit der Entscheidung erfüllt – so die Schlussfolgerung aus dem Gedankenexperiment – nicht den Anspruch, den ein Libertarier an eine Entscheidung stellt: vom Entscheider frei, aber kontrolliert herbeigeführt worden zu sein. Das Gedankenexperiment scheint damit auf die Unmöglichkeit einer libertarischen Position hinzudeuten.
Dieses Gedankenexperiment ist unter der Annahme formuliert, dass der Entscheidungsprozess entweder nach Art einer Naturgesetzlichkeit verläuft, oder, wenn dies ausgeschlossen wird, dem schlichten Zufall überlassen bleibt. Entsprechend analysiert Alfred Mele das „Zufalls-Szenario“ entlang eines Roulette-Modells: Welche Entscheidung fällt, ist so zufällig wie die Position der Kugel im Roulette-Rad. Abhängig von den Meinungen und Wünschen des Entscheiders können bestimmte Entscheidungsoptionen ein höheres Gewicht haben (ein größeres Zahlensegment im Roulette-Rad belegen). Am Ende aber entscheidet der Zufall über die ergriffene Option.
Die Alternative von kausaler Notwendigkeit oder stochastischer Zufälligkeit wird dem Phänomen der Entscheidung nicht gerecht. Folgendes Beispiel soll in der weiteren Argumentation zur Verdeutlichung dienen: Familienvater A bekommt ein attraktives Jobangebot eines konkurrierenden Unternehmens, das mit einem Wohnortwechsel verbunden wäre. Nach einigen Erkundigungen, Gesprächen und Abwägungen, entscheidet er sich für die neue Stelle.[5]
Hatte A wirklich eine Wahl? Hätte er in der gegebenen Situation auch anders entscheiden können? Und wenn ja, hat der Zufall für ihn entschieden oder hat er die Entscheidung selbst in der Hand gehabt?
Wie stellt sich das deterministische Szenario des Replay Gedankenexperiment angewandt auf das obige Beispiel dar? Es muss mehr besagen als die schlichte Trivialität: Wenn der Prozess des Überlegens gleich verlaufen wäre, wäre die Entscheidung wieder für den Jobwechsel gefallen. Ein Determinist muss annehmen, dass die gleichen Motive, Interessen, Wünsche und Befürchtungen wieder vorliegen, diese notwendig den gleichen Überlegens- und Diskussionsprozess evozieren und zur gleichen Entscheidung führen. Kurz gesagt: Mit der gleichen Ausgangssituation liegen die gleichen psychischen Motivatoren vor, und aufgrund der gegebenen psychisch neuronalen Gesetzmäßigkeit führen diese zur gleichen Entscheidung.
Vorsicht: petitio principii
Der Überlegens- und Entscheidungsprozess, der auf diese Weise aufgefasst wird, steht im Risiko einer petitio principii. Der Prozess des Überlegens wird nach Art eines Naturprozesses verstanden. Er ist so per Konstruktion mit einem deterministischen Weltverständnis vereinbar. Umgekehrt lässt sich dann jedoch kein Argument für die Vereinbarkeit des Willens-Phänomens mit einem Determinismus ableiten. Andernfalls würde das Risiko der petitio principii eintreten.
Tatsächlich wird das Phänomen des Überlegens subjektiv auf andere Art erfahren. Überlegen und Meinungsbildung sind keine anonym ablaufenden Prozesse, die einer strengen Gesetzmäßigkeit folgen. Sie sind Prozesse, die von einer Person oder einem Selbst geführt und durchgeführt werden. Die Person ist es, die überlegt und den Prozess der Überlegung vorantreibt.
„Zufall und Notwendigkeit“
Welche Rolle spielt aus dieser Perspektive der Zufall? Oder ist es zur Verteidigung der libertarischen Position gar nicht notwendig, sich mit dieser Rolle auseinanderzusetzten? Genügt es eventuell, das Gedankenexperiment, weil irreal und kontrafaktisch, auf die Seite zu stellen, und umgekehrt darauf hinzuweisen, dass die Erfahrung eines realen Spielraums im Überlegen ein psychisches Faktum a priori ist, und dass der Prozess nicht einer Naturgesetzlichkeit folgt, sondern der Logik der Gedankenführung einer Person? Lässt man sich mit der Frage nach dem Zufall nicht zu sehr von dem Gedankenexperiment vereinnahmen?
Stellt man die Frage nach dem Zufall phänomenologisch und nicht entlang unausgewiesener Modelle wie dem Roulette-Modell, kann sie zur Aufdeckung wichtiger Aspekte des Überlegens beitragen.
Das Phänomen des Überlegens hat als rationaler Prozess viele Facetten. Überall dort, wo innerhalb der Überlegung keine Deduktion – also eine logische Schlussfolgerung nach der Art eines Kalküls – stattfindet, kann der Aspekt des Zufalls eine Rolle spielen. Im Deutschen spricht man hier von „Einfall“, „Ideenfindung“, „Ideation“ oder „Assoziation“.
Bestimmte Dinge müssen dem Akteur bei der intellektuellen Suche nach der besten Option einfallen. Dass bestimmte Einfälle sich einstellen und andere nicht, liegt nur zu einem bestimmten Grad in der Macht der Person. Dies sind mögliche Abstufungen:
- Person A kann sich auf Grund ihrer Erfahrung darauf verlassen, dass ihr X in einer bestimmten Situation einfällt.
- Person A hätte in einer bestimmten Situation Y einfallen müssen – es war ihr zuzumuten oder zuzutrauen, auch wenn sie in der Situation nicht auf die Idee Y gekommen ist.
- Dass Person A Einfall Z hatte, war genial. Darauf wäre so leicht kein anderer gekommen.
Bedenkt man weiter, dass die Zeit der Überlegung häufig durch das bevorstehende Verstreichen einer Gelegenheit begrenzt ist, verschärft sich der Einfluss des Zufalls noch einmal. Die Zeit, in der sich eine Idee einstellen könnte, ist begrenzt.
An keiner Stelle genügt diese Zufälligkeit dem Modell eines Roulette-Spiels. Es ist kein anonymer, stochastischer Zufall, der die Entscheidung bestimmt. Die Person bestimmt die Entscheidung, indem sie nach der besten Entscheidungsoption strebt, und dabei aktiv nach Einfällen sucht. Ob sich die (besten) Ideen einstellen, liegt nur begrenzt in der Macht der Person und hängt in unterschiedlichen situativen Ausprägungen vom Zufall ab.
Dieser Zufall ist eine Facette der Unsicherheit, die eine Person im Prozess des Überlegens erfährt und in der Entscheidung überwinden muss. Deswegen wird die Entscheidung auch Entschluss genannt. Und deswegen ist in der Entscheidung Entschlossenheit gefordert.
Eine weitere Facette ist die Ungewissheit der richtigen Wahl. Es ist nur begrenzt im Voraus vorstellbar, wie es ist, eine bestimme Entscheidung getroffen zu haben und mit dieser Entscheidung zu leben.
Die kurze Untersuchung des Replay Gedankenexperiments und des Roulette-Modell des Zufalls hat ergeben, dass darin insbesondere die Rolle der Person und des Zufalls unverstanden bleiben.
Wie steht es mit der reflexiven Selbstkonsistenz eines Determinismus, aus dem sich diese Gedankenexperimente und Modelle speisen?
Fehlen der Selbst-Reflexivität
Ist eine deterministische Position ohne Selbst-Widerspruch vertretbar? Zur Beantwortung dieser Frage ist es wichtig zu verstehen, was es heißt, eine philosophische Position zu vertreten? – Grob gesprochen, bedeutet es, selbst von der Richtigkeit der Position überzeugt zu sein, und andere durch geeignete Argumente überzeugen zu wollen.
Der Prozess des Überzeugens ist geprägt von einer Reihe von Entscheidungen; er basiert selbst auf einer Entscheidung. Mit ihr bringt der Proponent zum Ausdruck, dass er seine Position für so wichtig hält, dass er sich dafür einsetzen wird, andere von der Wichtigkeit und Richtigkeit der Position zu überzeugen. Innerhalb dieses Unternehmens ist eine Reihe weiterer Entscheidungen zu treffen. Der Proponent muss festlegen, wie er seine Argumente aufbereitet, wie er erstes Feedback einholt, wie er seine Überlegungen an eine breitere Öffentlichkeit bringt, wie er sich der öffentlichen Diskussion stellt usw.
Aus der Akteurs-Perspektive spielt in all diesen Aktivitäten der freie, libertarisch verstandene Wille eine wesentliche Rolle. Überall muss der Proponent zwischen verschiedenen Optionen abwägen; diese Abwägung folgt nicht der Frage: Welche ist die eine, einzige Option, die kausal vorherbestimmt ist? Es hat vielmehr zum Ziel, die beste Option zu finden – die Option, die in der gegebenen Situation den angestrebten Zweck am besten erfüllt.
Dabei werden manche Optionen als ungangbar ausgeschlossen – ungangbar meist nicht in einem naturwissenschaftlichen Sinn, also in dem Sinne, dass sie physikalisch (in der gegebene Situation) ausgeschlossen sind. Die Ungangbarkeit hat hier in der Regel einen schwächeren Charakter. Vielleicht sprechen gesetzliche Rahmenbedingungen gegen eine Option oder die Weigerung eines Beteiligten.
Manche Optionen werden sich dem Proponenten als real gangbar zeigen, aber als weniger geeignet als andere Optionen.
In seltenen Fällen werden verschiedene Optionen als gleichermaßen geeignet erscheinen. Hier wird der Proponent willkürlich entscheiden, oder gar ausdrücklich einem Zufallsereignis wie einem Münzwurf die „Entscheidung“ überlassen.[6]
Bei all diesen Überlegungen und Entscheidungen mag ein Determinist zugestehen, dass sie aus der Ich-Perspektive so erscheinen mögen, als hätte der Akteur eine Wahl, als hätte er tatsächlich mehrere reale Optionen. Für den Deterministen nimmt sich das jedoch als Täuschung aus. Tatsächlich ist nach dessen Ansicht schon vor Beginn des Überlegens für jede der gefällten Entscheidungen mit kausaler Notwendigkeit festgelegt, welche Option ergriffen wird.
In dem hier betrachteten Fall handelt es sich jedoch nicht um einen unbestimmten, anonymen Dritten, sondern um den Deterministen selbst. Indem er sein eigenes Überlegen und Argumentieren als determiniert auffasst, wird die Annahme oder Überzeugung der Determiniertheit Teil des Prozesses seines Überlegens. Was bewirkt dieser mitlaufende Gedanke, wie ändert er die Überlegungen?
Mindestens fünf Optionen sind denkbar: (1) Der Determinist folgert, da alles determiniert ist, dass er nichts ändern kann und er deswegen in seinem Abwägen und Argumentieren so fortfahren wird, wie er es bisher getan hat. (2) Er könnte es aus demselben Grund auch unterlassen, überhaupt zu entscheiden und „den Dingen seinen Lauf lassen“. (3) Der Determinist könnte versuchen, sein Überlegen und Abwägen anders anzugehen. Er könnte versuchen, seine Entscheidungen naturwissenschaftlich abzuleiten und persönliche Wertungen zu vermeiden. (4) Er könnte auch zur nächsten reflexiven Stufe fortschreiten, und erwägen, dass die Reflexion auf die Determiniertheit seiner Überlegungen selbst determiniert ist. Dies würde ihn in einen unendlichen Regress führen. (5) Oder er könnte anfangen zu bezweifeln, dass eine deterministische Position auf sein eigenes Überlegen und Argumentieren anwendbar ist. Er wäre damit auf einen Präzedenzfall von Indeterminiertheit gestoßen.
Performativer Widerspruch
Vielleicht hat der Determinist nicht all diese Optionen präsent, vielleicht hat er mehr und andere Optionen, die er abwägen muss. In jedem Fall befindet sich der Determinist erneut in einem Spielraum realer Möglichkeiten. Aus seiner Perspektive als Akteur muss er aus einer Überlegung heraus eine Wahl und Entscheidung treffen. Diese Entscheidung ist hier mehr als in vielen anderen Situationen von rationalen Erwägungen bestimmt, sie lässt sich aus der Akteurs-Perspektive aber nicht als Prozess naturwissenschaftlich kausaler Notwendigkeit auffassen.
Daraus wird deutlich, dass die deterministische Deutung von Überlegung, Wahl und Entscheidung zwar als Zuschreibung in der 3. Person funktionieren mag. Sie funktioniert ohne Selbst-Widerspruch aber nicht aus der Ich-Perspektive als reflexive Deutung des eigenen Überlegens und Entscheidens. Der Determinist bleibt in einem performativen Widerspruch gefangen. Der Inhalt und das Ziel seiner Argumentation stehen für einen Determinismus, sein Verhalten ist Ausdruck libertarischer Freiheit.
Wie kann er diesen performativen Widerspruch überwinden? Er kann sich daraus befreien, indem seine deterministische Position für sich selbst als unanwendbar akzeptiert und anerkennt, dass sein eigenes Räsonieren, Überlegen und Entscheiden notwendig im Spielraum der Freiheit stattfindet.
Wie steht es aber mit dem Gegenüber, das er überzeugen will? Wie stellt sich ihm der Adressat seiner Argumente dar? – Er wird dem Adressaten ein mehr oder weniger klar artikuliertes Interesse an der Thematik von Willensfreiheit und Determinismus unterstellen. Basierend darauf wird der Determinist ihm zunächst die Problemstellung unterbreiten. Er wird annehmen, dass der Adressat von der deterministischen Position noch nicht (hinreichend) überzeugt ist, und wird ihm deswegen Argumente für die Richtigkeit des Determinismus und gegen die Möglichkeit einer libertarischen Position vorlegen. Er wird versuchen, die Argumente so anzulegen, dass sie vom Gegenüber nicht angreifbar sind. Er wird sich dabei auf geteilte Überzeugung und gemeinsame Regeln der Schlussfolgerung stützen. Er wird die Richtigkeit und Eignung seiner Argumente dadurch auf die Probe stellen, dass er Einwände und Gegenargumente des Gegenüber anhört, bewertet, erwidert und ggf. in sein eigenes Argumentieren integriert. Womöglich sind die Einwände so überzeugend, dass der Determinist an seiner Position zu zweifeln beginnt oder sie gar vollständig aufgibt.
Was zeigt diese Darstellung? Zunächst fällt auf, dass die Rollen des Deterministen und seines Gegenüber im Austausch der Argumente symmetrisch sind. Geteilte Überzeugungen und rationale Standards, das adressatengerechte Ausgestalten der Argumente, das Hören der Argumente des Gegenüber und die Offenheit des Ausgangs des rationalen Diskurses – all das zeugt davon, dass der andere ein alter ego für den Deterministen ist, und nicht ein Substrat determinierter, naturwissenschaftlicher Prozesse.
Wie stellt sich von hier aus das Überzeugt-werden dar – beschrieben in der Ich-Perspektive, die – so hat sich eben gezeigt – auch die Perspektive ist, die der Determinist dem Adressaten seiner Argumente als alter ego unterstellen muss?
Mit dieser Frage wird ein großes Kapitel der Philosophiegeschichte aufgeschlagen. Hier soll nur ein bescheidener Beitrag versucht werden – entlang des Beispiels der Determinismus-Debatte und mit Blick auf die Selbst-Konsistenz dieser Debatte.
Basierend auf dem Interesse an dieser Debatte wird sich für den Adressaten der Überzeugungsarbeit zunächst die Problem- oder Fragestellung schärfen. Typischerweise stellt sich das Problem als ein Widerstreit gleichermaßen plausibler Annahmen dar – hier als der Widerstreit der Erfahrung libertarischer Freiheit und der prinzipiellen naturwissenschaftlichen Erklärbarkeit beliebiger Ereignisse. Damit ist ein definierter Spielraum möglicher Antworten und Positionen eröffnet. Mit Rekurs auf relevante Überzeugungen und Rationalitätsstandards werden ihm Argumente für und wider die verschiedenen Positionen dargelegt; diese wird er bewerten und mit seinen eigenen Überzeugungen abgleichen. Am Ende wird der Adressat der Überzeugungsarbeit eine eigene, möglichst konsistente Position im Spielraum der Positionen einnehmen. Es wird die Position sein, die er angesichts seiner eigenen Grundüberzeugungen vor sich und anderen am besten vertreten kann. Bei dem fundamentalen Charakter der Determinismus-Debatte wird er aber auch die Erkenntnis gewonnen haben, dass andere an dieser Debatte Beteiligte bei gleicher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zu anderen Schlussfolgerungen und Positionen gelangt sind, und dass es ausgeschlossen ist, alle an der Debatte Beteiligten rational auf eine gemeinsame Position zu verpflichten.
Wie nimmt sich dieser Prozess der Überzeugungsarbeit im Vergleich mit einer deterministischen Beschreibung aus? – Die an der Debatte beteiligten bewegen sich durchgehend in einem Spielraum von Positionen. Die Festlegung auf eine Position ist hier kein Akt des Beliebens. Habermas spricht vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Aber auch mit der Festlegung auf eine Position bleibt das Bewusstsein der Vertretbarkeit anderer Positionen. Und der angesprochene Zwang des besseren Arguments ist kein solcher von naturgesetzlicher Notwendigkeit, sondern der eines rationalen Sich-zu-eigen-machens einer Position basierend auf den eigenen Grundüberzeugungen. Die Vorstellung, das Überzeugt-sein von einer Position hätte sich naturgesetzlich eingestellt, würde vielmehr das Fundament des Überzeugt-seins untergraben.
Wie oben erwähnt, kann all das hier aus der Ich-Perspektive Beschriebene in der 3. Person auch deterministisch gedeutet werden. Mit diesem Perspektivenwechsel springt der Determinist jedoch aus der Debatte heraus. Innerhalb der Debatte geht er als „Ich“ mit einem alter ego um. In der deterministischen Deutung werden ihm die anderen Personen zu Objekten naturgesetzlicher Notwendigkeit. Doch auch diese Deutung muss sich notwendig im Medium der Sprache vollziehen; Sprache im Allgemeinen, wie die Determinismus-Debatte im Besonderen, entziehen sich im Vollzug einer deterministischen Deutung.
Solange der Determinist sich in der Determinismus-Debatte bewegt – so kann resümierend festgehalten werden -, muss er sich selbst und die Adressaten seiner Argumente als frei in einem libertarischen Sinn verstehen. Er bewegt sich damit durchgehend in einem performativen Widerspruch, dem der auch dann nicht entkommen kann, wenn er aus der Debatte herausspringt und sie in einer deterministischen Deutung objektiviert.
Abschließende Bemerkungen
Die vorliegende Untersuchung spricht sich gegen einen Determinismus und für die libertarisch verstandene Freiheit aus. Folgende Thesen wurden mit Argumenten untermauert:
- Der Determinismus setzt die naturwissenschaftliche Erkenntnis und Forschungshaltung absolut. Er kann sich bei dieser Absolut-Setzung nicht auf die Naturwissenschaften berufen, und ist in diesem Sinne selbst unwissenschaftlich.
- Der Determinismus fasst das Phänomen der Willensfreiheit nach dem Muster naturwissenschaftlich mathematischer Modelle und kann kein adäquates Verständnis von Zufall, Ungewissheit und Person im Kontext des Überlegens und Entscheidens entwickeln.
- Eine deterministische Position ist nicht ohne Selbst-Widerspruch vertretbar. Jedes Argumentieren und Deuten setzt im Vollzug notwendig einen libertarisch verstandenen Freiheitsspielraum voraus.
Mit der Ablehnung eines Determinismus bleibt die Frage als philosophische Herausforderung offen, wie das stetig wachsende Konvolut naturwissenschaftlicher Erkenntnis und die persönliche Erfahrung von Freiheit in ein kohärentes Ganzes philosophischer oder wissenschaftlicher Theorie integriert werden können. Es sind erste Versuche zu verzeichnen, die sich auf Quantenphysik oder Chaostheorie stützen, oder wie bei Hans Jonas auf phänomenologische Ansätze bauen. Insgesamt steht die philosophische Auseinandersetzung hier am Anfang.
[1] „Phänomen des Willens“ steht hier wie im Folgenden für den Bereich menschlicher Praxis, der alle Formen des Überlegens, Entscheidens und Handeln einschließt.
[2] Im Folgenden wird, wenn nicht ausdrücklich unterschieden, die Bezeichnung „Determinismus“ auch kompatibilistische Positionen einschließen. Dabei basiert eine deterministische Position gemäß dem hier verwendeten Verständnis auf der Grundüberzeugung, dass jedes Ereignis in der Welt eindeutig und notwendig aus den relevanten Aspekten eines früheren Weltzustands und den relevanten Naturgesetzen hervorgeht. Kurz gesprochen: Jede Veränderung in der Welt ist alternativlos.
Im Unterschied dazu geht eine libertarische Position davon aus, dass uns als handelnde Personen zumindest in manchen unserer Überlegungen und Entscheidungen mehrere reale Optionen zur Wahl stehen.
[3] wiewohl Searle diese Position nicht unterstellt werden soll
[4] Mit der Entwicklung der Quantenphysik ist die Vorstellung von kausaler Determiniertheit auf den Anwendungsbereich der klassischen Physik eingeschränkt worden. Aber auch die Quantenphysik stellt Naturgesetze, wie etwa Schrödinger-Gleichungen, ins Zentrum ihrer Theoriebildung.
[5] Prozesse des Überlegens, Entscheidens und Handeln, wie sie hier exemplifiziert sind, sind gemeint, wenn in dieser Untersuchung kurz von „Wille“ gesprochen wird.
[6] Es ist wenig hilfreich, dass Libertarier wie Kane die Situation einer echten Wahl auf wenige, außergewöhnliche Falle beschränken – z.B. auf solche Fälle, in denen ein Konflikt von Grundinteressen einer Person zu Tage tritt. Dadurch wird die Begründungspflicht nur unwesentlich vermindert, und gleichzeitig wird der praktischen Erfahrung nicht ausreichend Rechnung getragen. Wie steht es mit dem Fall, in dem Person A in ein großes Gebäude eintreten will, das zwei nebeneinander liegende Zugangstüren hat? Ist tatsächlich anzunehmen, dass Person A keine echte Wahl zwischen zwei realen Optionen hat?