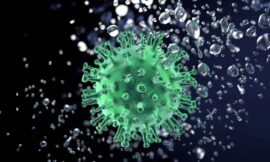Aus gegebenem Anlass
KEL zum 28.
Die Ethik fragt nach dem „höchsten Gut“. Traditionell findet sich darauf als Antwort das gute Leben, die Eudaimonia (εὐδαιμονία), ein Leben, das durch einen guten Geist (εὐ δαίμων) bestimmt wird. Nicht alles Gute ist immer und unter allen Umständen gut – wir „bewerten“ als „gut für“ das gute Leben. Dem Guten steht das Schlechte und Böse entgegen. Hier scheint es Dinge zu geben, die „ohne Einschränkung“, immer und unter allen Umständen, „böse“ genannt werden kann. Seit der Aufklärung gilt die Folter als ein malum in se. Doch die Sache ist umstritten. Rechnen wir die Folter gemeinhin zum Schlimmsten, was uns angetan werden kann, so stellt sie uns doch genau deshalb vor die Wahl. Es war und ist ein Mittel der Politik und des Kampfes gegen das Böse, das geschichtlich erst spät geächtet wurde. Entzieht sich die Folter tatsächlich jeder Güterabwägung? Wie steht es z.B. mit der Folter die (vermeintlich) tausende Folterungen verhindert? Utilitaristisch und konsequentialistische Ethiken kommen da in Schwierigkeiten. Vieles hängt davon ab, was wir als Folter verstehen wollen – und im Unterschied zu anderen Zwangsmaßnahmen verstehen sollten.
Sie ist „grausam“ und wird deshalb von einigen Autoren in den umfassenderen Bereich dessen gestellt, was wir Grausamkeit nennen. Für Richard Rorty und Martin Seel z.B. ist die „Grausamkeit das Schlimmste“ und die Folter gegebenenfalls (?!) „nur“ ein Fall eines tiefergreifenden Übels. Für Martin Seel ist Grausamkeit der „Inbegriff der menschlichen Bösartigkeit“, die sich von allen anderen Schlechtigkeiten des menschlichen Charakters unterscheidet. Ihr fehlt jede „moralische Ambivalenz“: wer als grausam zu gelten hat, ist „ohne jede Zweideutigkeit schlecht“.[1]
Michel de Montaigne

Beide, Rorty und Seel, haben einen berühmten Vorgänger, der für den „Vorrang“ der Grausamkeit der topos classicus ist: Michel de Montaigne (1533 – 1592) hat der Grausamkeit einen Essai gewidmet und bekennt dort: „Ich hasse unter andern Lastern die Grausamkeit ganz grausam von Natur und aus Überlegung, als das größte unter allen Lastern.“[2] Montaigne beweist nicht, er versteht seine Wertung eher als eine Form der Selbsterkenntnis seiner höchst persönlichen „Tugendausstattung“. Wer von der Lektüre Montaignes begriffsstrenges Philosophieren erwartet, der wird enttäuscht sein. Nur wenige der 30 Seiten des Kapitels Von der Grausamkeit sprechen wirklich über Grausamkeit. Montaigne raisoniert zunächst ausführlich über die alte Frage, ob der innere Kampf gegen Widerstände die Tugend auszeichnet oder die ruhige, gelassene Selbstverständlichkeit des Charakters, die dem „Weisen“ zur zweiten Natur geworden ist. Auch diese Frage ist persönlich motiviert. Montaigne stellt nämlich für sich fest, dass die Natur ihn mit milden Strebungen und Trieben ausgestattet hat, und es aufgrund dieser Veranlagung für ihn keiner großen Anstrengung bedarf, vergleichsweise selbstbeherrscht zu leben. Er sieht sich in einer „einfältigen Unschuld, die sehr wenig Lebhaftigkeit“ hat. Er ist „so weichherzig“ und nah am Wasser gebaut, dass er ohne eigenes Verdienst sich frei von grausamen Exzessen weiß.
In Von der Grausamkeit begegnet uns wie in allen Essais Montaignes ein wahrhaftiges Streben nach Selbsterkenntnis und Orientierung. Montaigne kann uns durch Vorbild und Vielfalt der angeführten Phänomen empathisch in unserem eigenen Bestreben der Selbstbesinnung stärken. Er will freilich keine Theorie geben, deren Nachvollzug uns zur Tugend und Weisheit führt. Angesichts der systematisch vorgehenden Stoiker, die bei der Tugend begrifflich „alles ganz einfach“ sehen, hegt er den Verdacht der erfahrungsarmen und selbstgefälligen Schulweisheit. „Die Erfahrung lehret mich das Gegentheil.“[3] Die Vielfalt des wirklichen Lebens und seiner Phänome ist gegen die „eitlen Spitzfindigkeiten“ auch der besten philosophischen Schulen zu stellen, von denen auch Montaigne vieles zu lernen weiß. Und das darf vielleicht als methodisches Programm Montaignes überhaupt verstanden werden.
Es sind „harte“ Zeiten, in denen Montaigne lebt. Glaubens- und Bürgerkriege prägen das Leben. Montaigne erkennt an sich selbst, dass ihm nichts so widerlich ist wie die Grausamkeit, die sich darin ausbreitet. Sucht Montaigne Orientierung in der Tradition, dann findet er darin kaum etwas über Grausamkeit als (vorrangiges) Laster. Der klassische, kardinale Tugendkatalog mit Gerechtigkeit(δικαιοσύνη), Tapferkeit (ἀνδρεία), Besonnenheit (σωφροσύνη) und Klugheit (φρόνησις) hat seinen Gegenpart in den kardinalen Lastern der Ungerechtigkeit (ἀδικία), Feigheit (δειλία), Zügellosigkeit (ἀκολασία) und Unbesonnenheit (ἀφροσύνη).[4] Und auch die Todsünden verweisen nicht auf grausames Handeln oder Foltern. Sie kennen den Hochmut (superbia), die Trägheit (acedia), die Vergnügungssucht (luxuria), den Zorn (ira), die Genußsucht (gula), den Neid (invidia) und den Geiz (avaritia).[5] Für die Tradition ethischen Denkens scheint die Grausamkeit von nachrangiger Bedeutung. Wir gewinnen von dort keinen rechten Aufschluss über das, was sie ist.
Richard Rorty

Gewiss dürfen wir auch von Richard Rorty keine endgültige, metaphysische Wesensdefinition der Grausamkeit erwarten. Er geht vielmehr aus von der Gruppe der „Liberalen“, die er mit Judith Shklar [6] als Menschen versteht, „die meinen, dass Grausamkeit das Schlimmste ist, was wir tun“.[7] Zu diesen Menschen werden wir auch Rorty rechnen dürfen. Die Referenz auf eine „kontingente“ „wir“-Gruppe ist für Rorty „natürlich“ schon deshalb wichtig, weil es für ihn „keine nicht-zirkuläre theoretische Begründung für die Überzeugung, dass Grausamkeit schrecklich ist“ geben kann.[8]
 Rorty und seine liberale Ironikerin[9] nähern sich der Grausamkeit „literarisch“. Sie erscheint als die „Demütigung“, die darin besteht, jemanden unfähig zu machen, sich selbst zu beschreiben und eine Geschichte von sich so erzählen zu können, dass in ihr ein sinnvolles Ganzes aus Überzeugungen, Wünschen und Antrieben erscheint. Das erscheint beiden, Rorty und der liberalen Ironikerin als die „stärkste Form der Grausamkeit“. Die liberale Ironikerin setzt auf die Kraft der Beschreibung und Neubeschreibung. „Aber die meisten Menschen wollen nicht neubeschrieben werden. Sie wollen so genommen werden, wie sie sich selbst verstehen.“[10] Die liberale Ironie der Sprachspiele und Kreationen hat „etwas potentiell sehr Grausames“: „Denn die wirksamste Weise Menschen anhaltenden Schmerz zuzufügen, besteht darin, sie zu demütigen, indem man alles, was ihnen besonders wichtig schien, vergeblich, veraltet, ohnmächtig erscheinen lässt.“[11]. Rorty verweist auf ein Kind, dessen „geliebte Schätze“ mit denen eines „reicheren“ Kindes verglichen und lächerlich gemacht würden – „die kleinen Gegenstände, die es mit Phantasien umkleidet, durch die es verschieden von allen anderen Kindern wird – auf einmal als Müll neubeschrieben und weggeworfen werden“.[12] Auch das mag grausam sein, ist aber doch nicht das geeignetste Beispiel, wenn wir das Wort „grausam“ einführen wollten – jedenfalls für den von Rorty nicht sonderlich geliebten „gesunden Menschenverstand“.[13] Mit Blick auf die Qualen in den Folterkellern und auf den Marterplätzen der Geschichte, dem darin allgegenwärtigen Kriegsgemetzel und der mitleidslosen Behandlung von Kriegsgefangenen als Sklaven, kommt dem vielleicht etwas einfältigen „gesunden Menschenverstand“ die abschätzige Behandlung des Kinderspielzeugs eher als „nebensächlich“ vor, als liberales Verspielt-sein mit Phantasien der eigenen Welt.[14] Bezeichnend ist der Beginn des ersten Kapitels des (dritten) Teils Grausamkeit und Solidarität in Rortys Kontingenz, Ironie und Solidarität: „Die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat, die ich im gesamten zweiten Teil gemacht habe, zielt darauf [!], daß wir Bücher, die unsere Autonomie fördern, unterscheiden von solchen, die uns helfen, weniger grausam zu sein.“[15]
Rorty und seine liberale Ironikerin[9] nähern sich der Grausamkeit „literarisch“. Sie erscheint als die „Demütigung“, die darin besteht, jemanden unfähig zu machen, sich selbst zu beschreiben und eine Geschichte von sich so erzählen zu können, dass in ihr ein sinnvolles Ganzes aus Überzeugungen, Wünschen und Antrieben erscheint. Das erscheint beiden, Rorty und der liberalen Ironikerin als die „stärkste Form der Grausamkeit“. Die liberale Ironikerin setzt auf die Kraft der Beschreibung und Neubeschreibung. „Aber die meisten Menschen wollen nicht neubeschrieben werden. Sie wollen so genommen werden, wie sie sich selbst verstehen.“[10] Die liberale Ironie der Sprachspiele und Kreationen hat „etwas potentiell sehr Grausames“: „Denn die wirksamste Weise Menschen anhaltenden Schmerz zuzufügen, besteht darin, sie zu demütigen, indem man alles, was ihnen besonders wichtig schien, vergeblich, veraltet, ohnmächtig erscheinen lässt.“[11]. Rorty verweist auf ein Kind, dessen „geliebte Schätze“ mit denen eines „reicheren“ Kindes verglichen und lächerlich gemacht würden – „die kleinen Gegenstände, die es mit Phantasien umkleidet, durch die es verschieden von allen anderen Kindern wird – auf einmal als Müll neubeschrieben und weggeworfen werden“.[12] Auch das mag grausam sein, ist aber doch nicht das geeignetste Beispiel, wenn wir das Wort „grausam“ einführen wollten – jedenfalls für den von Rorty nicht sonderlich geliebten „gesunden Menschenverstand“.[13] Mit Blick auf die Qualen in den Folterkellern und auf den Marterplätzen der Geschichte, dem darin allgegenwärtigen Kriegsgemetzel und der mitleidslosen Behandlung von Kriegsgefangenen als Sklaven, kommt dem vielleicht etwas einfältigen „gesunden Menschenverstand“ die abschätzige Behandlung des Kinderspielzeugs eher als „nebensächlich“ vor, als liberales Verspielt-sein mit Phantasien der eigenen Welt.[14] Bezeichnend ist der Beginn des ersten Kapitels des (dritten) Teils Grausamkeit und Solidarität in Rortys Kontingenz, Ironie und Solidarität: „Die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat, die ich im gesamten zweiten Teil gemacht habe, zielt darauf [!], daß wir Bücher, die unsere Autonomie fördern, unterscheiden von solchen, die uns helfen, weniger grausam zu sein.“[15]
Wenn Rorty mit seiner liberalen Ironikerin der Grausamkeit nachgeht, dann ausdrücklich in der ihm eigenen „wir“-Welt der liberalen Humanities-Intellektuellen. Es verwundert dann nicht mehr, dass Rorty von der ersten Form von Grausamkeit als einem „Mangel an Neugier“[16] spricht, nämlich der Unfähigkeit, irgendetwas wahrzunehmen, was für die eigenen Obsessionen irrelevant ist. Wenn man so will, folgt Rorty dem Vorbild Montaignes und versucht eine um Wahrhaftigkeit bemühte Selbsterkenntnis, eine „Psychoanalyse“ der eigenen Existenz. Es geht Rorty nicht darum, was Grausamkeit „an sich“ und im Allgemeinen ist – darüber lässt sich vermutlich nach Rorty wenig Sinnvolles sagen. Er will etwas „Interessantes“ sagen, etwas, das das Vokabular erweitert und neue Sichten freigibt. Zur Wahrhaftigkeit gehört Distinktion und das Sich-unverwechselbar-Erfinden.
Martin Seel

Dagegen finden wir in Martin Seels „philosophischer Revue“ der Tugenden und Laster eine Beschreibung, die das Wesen der Grausamkeit zumindest umkreist: „Grausam sind Handlungen, die die leibliche oder seelische Integrität von Lebewesen ohne Rücksicht auf ihr Wohlergehen verletzen; grausam sind Menschen, die eine Disposition zu solchen Handlungen haben.“[17] Grausamkeit ist eine Charaktereigenschaft, die Grausamkeiten hervorbringen lässt. Solche Grausamkeiten können auch bei Seel Demütigungen sein, aber eben auch „Akte der Vergewaltigung und der physischen und psychischen Folter“. Grausamkeit bezieht sich jedenfalls auf ein leidensfähiges Wesen, dem Schmerzen nur zugefügt werden dürfen, wenn damit – wie im Falle eines ärztlichen Eingriffs – sein Wohlergehen im Großen und Ganzen gefördert wird. In diesem Sinne sprechen wir auch von „grausamen Schmerzen“ oder von der „grausamen Lage“, in der sich jemand befindet. Die zerstörerische Wirkung, die davon auf das Wohlergehen des Lebewesens ausgeht, hat Seel vermutlich im Blick, wenn er von der „leiblichen und seelischen Integrität“ spricht, die durch Grausamkeit verloren zu gehen droht. Obwohl Seel die Grausamkeit ethisch als Charaktereigenschaft eines Handelnden in den Blick nimmt, erschließt sie sich zunächst über die Wirkung auf das Opfer. Von „grausamen Schmerzen“ nach einer Operation oder bei einer Nierenkolik sprechen wir ohne irgendwem oder -was Grausamkeit zu unterstellen. Und natürlich ist auch der Arzt, der eine Operation ohne Narkose durchführen muss, nicht grausam. Er wäre es nur dann, wenn er verfügbare Schmerz- und Betäubungsmittel aus „sachfremden“, d.h. anderen als therapeutischen Gründen nicht zum Einsatz brächte.
 Vom Opfer her bewerten[18] wir die Grausamkeit auch dann, wenn wir vom „grausamen Löwen“ sprechen oder es als grausam empfinden, wenn Katzen den Tod ihrer „Opfer“ hinauszögern und das Sterben der Mäuse „spielerisch“ verlängern. Auch Kinder können bekanntlich grausam sein. Das mag zunächst auf ihr Unverständnis zurückzuführen sein bzw. ihre Unfähigkeit, das Leiden der anderen empathisch mitzuerleben. Es liegt aber auch nahe, dass sie ihr Handeln „austesten“ und gerade damit spielen, anderen Schmerzen zuzufügen. So erleben sie z.B. die Macht, die sie über andere haben und finden daran insofern Gefallen als sie so die „Realität“ ihres Handelns erleben. Das wäre dann sogar ein Fall jener „Ambivalenz“, die Seel gerade bei Grausamkeit ausschließen möchte.
Vom Opfer her bewerten[18] wir die Grausamkeit auch dann, wenn wir vom „grausamen Löwen“ sprechen oder es als grausam empfinden, wenn Katzen den Tod ihrer „Opfer“ hinauszögern und das Sterben der Mäuse „spielerisch“ verlängern. Auch Kinder können bekanntlich grausam sein. Das mag zunächst auf ihr Unverständnis zurückzuführen sein bzw. ihre Unfähigkeit, das Leiden der anderen empathisch mitzuerleben. Es liegt aber auch nahe, dass sie ihr Handeln „austesten“ und gerade damit spielen, anderen Schmerzen zuzufügen. So erleben sie z.B. die Macht, die sie über andere haben und finden daran insofern Gefallen als sie so die „Realität“ ihres Handelns erleben. Das wäre dann sogar ein Fall jener „Ambivalenz“, die Seel gerade bei Grausamkeit ausschließen möchte.
Grausame Handlungen sind Akte Einzelner, können aber auch solche von „Kollektiven“ sein, „deren Mitglieder aus Motiven der Vergeltung zur Brutalität übergehen“. Auch bei Seel hat Grausamkeit wie bei Montaigne eine Zweideutigkeit. Grausame Handlungen können andere Motive haben, etwa die der Vergeltung. Sie können aber auch Selbstzweck sein und sind dann sadistisch. „Der Grausame nimmt die Schmerzen seines Gegenübers nicht wahr, oder sie sind ihm gleich – oder er ergötzt sich daran.“[19] Der Sadist ist in jedem Fall grausam, er gewinnt Lust aus dem Schmerz anderer und fügt ihn deshalb zu. Ihr „Wohlergehen“ wird dafür gänzlich dem eigenen geopfert. Das „Motiv der Vergeltung“, die schließlich zur „Brutalität“ verkommt, wird bei Montaigne am Beispiel „grausamer Strafen“ verhandelt. Grausam sind sie (nur) dann, wenn sie unverhältnismäßig, härter als notwendig und also unangemessen sind. Aus dieser Perspektive kann man (mit der Strafe) das Notwendige tun – „Strafe muss sein“ – ohne als grausam zu gelten. Das gilt nach Montaigne sogar bei der Todesstrafe, die nur dann als grausam gelten müsste, wenn sie nicht schnell und weitgehend schmerzlos vollzogen würde.
Vieles kommt dabei darauf an, wie man z.B. die erzieherische Wirkung von Prügelstrafe beurteilt. Gehörten sie jahrtausendelang zur Erziehung und galt der prügelnde Lehrer nicht als grausam – so lange er es nicht übertrieb, sehen wir das heute anders.[20] Der Unempfindlichkeit für das Leiden anderer kann freilich durch eine „Schule der Empfindsamkeit“ begegnet werden. Rorty, Seel und wohl auch Montaigne ziehen ihre Hoffnung aus dem Umstand, dass der Grausame zugleich gegen sich selbst Härte zeigen und „die eigenen Regungen der Zartheit und des Mitleids“ unterdrücken muss. Der Grausame ist grausam gegen sich selbst und sieht damit von seinem eigenen Wohlergehen ab. „Sein Tun ist nicht einmal zu seinem Guten.“[21]
Genealogie der Tugenden und Laster
Bei Montaigne sind die Überlegungen zur Grausamkeit eingebettet in die Frage, inwieweit die Tugend als Kampf gegen Widerstände nicht eine Härte gegen sich selbst voraussetzt. Die gegensätzlichen Tugendlehren der Antike, die der Stoa und Epikurs, gehen gleichermaßen davon aus, dass diese Härte eine Bedingung des eigenen Gut-Seins ausmacht. Montaigne konnte damit für sich nichts anfangen. Aber tatsächlich ist Tugend in ihrem Wesenskern damit verbunden.
Was wir ethisch meinen und im Deutschen mit „Tugend“ bezeichnen, leitet sich her vom Griechischen Arete, ἀρετή. ἀρετή ist das, was etwas gut macht (ἀγαθός). Etwas, das wir gut nennen (ἀγαθός), so dass es vollkommen das ist, was es ist, hat ἀρετή. Etwas künstlich ausgedrückt wäre sie die „Gutheit“ einer Sache, die gut oder schlecht sein kann.
Mit dem Ausdruck Gutheit einer Sache (ἀρετή) wird zugleich ausgedrückt, dass Tugend (ἀρετή) nicht auf Ethik oder Moral eingeschränkt ist. Tugend ist „unmoralisch“ in dem Sinne, dass damit die vor-moralische Güte einer Sache bewertet wird. Die Griechen können von der Tugend eines Messers genauso reden wie von der Tugend eines Pferds oder eben der Tugend eines Königs. Ihre Tugend macht sie vollkommen.[22] Das Pferd ist gut (ἀγαθός), hat ἀρετή, wenn es so ist wie wir uns ein Pferd idealer Weise vorstellen.
Was ἀρετή hat, ist edel. Das gilt auch und gerade für das, was den Menschen, seinen Hausstand (οἶκος) und sein politisches Zusammenleben (πόλις) betrifft. Unter Menschen ist ἀρετή das, was den Helden auszeichnet. Bei Homer steht sie für die Kraft, die den Helden zum Helden macht. Sie ist nicht in erster Linie eine „geistige“ oder gar sittliche Eigenschaft. Es ist die Gewandtheit des Helden „schön“ zu siegen.
 Der Held, wie er am griechischen Beginn der Ethik verstanden wird, sieht sich selbst immer im Wettkampf um den höchsten Preis.[33] Das Leben der Helden „ist ein steter Eifer des Sichaneinandermessens, ein Laufen um den ersten Preis.“[23] Bei Homer wird das als Selbstverpflichtung formuliert, die alle nachfolgende Ethik prägt: „Immer der erste zu sein und ausgezeichnet vor andern“ (αἰὲν ἀριστεύειν).[24]
Der Held, wie er am griechischen Beginn der Ethik verstanden wird, sieht sich selbst immer im Wettkampf um den höchsten Preis.[33] Das Leben der Helden „ist ein steter Eifer des Sichaneinandermessens, ein Laufen um den ersten Preis.“[23] Bei Homer wird das als Selbstverpflichtung formuliert, die alle nachfolgende Ethik prägt: „Immer der erste zu sein und ausgezeichnet vor andern“ (αἰὲν ἀριστεύειν).[24]
Aus der „vor-moralischen Güte“ des Helden kann sich dann auch die sittliche ergeben. ἀρετή zeichnet den „vornehmen“, „vorzüglichen“ Mann (ἄριστος) aus, macht seinen „Adel“ aus. Er misst sich an den Maßstäben des Heldischen und sieht sich durch seine Herkunft dazu verpflichtet: es ist ein Anspruch, der nicht für jeden ergibt – und insbesondere nicht für den „gemeinen“ Mann angeht. „Gemein“ macht ihn gerade, dass er nicht durch die Ansprüche gemessen wird, denen sich der Edle (ἄριστος) ausgesetzt sieht. Merkmal des „Adels“ ist die Verpflichtung, die er sich selbst auferlegt. Den Vorrang, den man behauptet, wird durch die ἀρετή errungen, deren Maßstab man sich unterstellt.
Die „Gutheit“ des Mannes, seine ἀρετή, lässt ihn siegreich sein. ἀρετή bezeichnet ein Können. Sie gibt ihm die „Macht“, vorzüglich und also der „Erste“ im Wettkampf zu werden. Und in diesem Sinne gibt sie Herrschaft.

ἀγαθός ist der Held nicht, weil er „ethischen“ oder „moralischen“ Normen (oder gar Gesetzen) folgt. Er folgt seiner „ertüchtigten Natur“ und setzt damit die Normen, nach denen gehandelt wird. Er schafft durch sein Wirken Ordnung. Sein Wirken ist ethisches „Vorbild“. Für seine „Ertüchtigung“ sind wiederum die „Helden“ des Mythos die maßgeblichen Vorbilder, der große Aias und Achill, Odysseus und Diomedes und natürlich vor allem Herakles. Um es etwas zugespitzt auszudrücken: Nicht das Gute „macht“ den Helden, vielmehr schafft der Held das Gute: gut (ἀγαθός) ist etwas, weil es den Helden zeigt, weil es vom edlen Mann herkommt, der mannhaft und tapfer ist (ἀνδρεῖος). Was wir mit Tapferkeit übersetzen, heißt griechisch ἀνδρεία und leitet sich von ἀνήρ, Mann, her. Sie ist das, was den Mann aus- und zu einem Edlen macht, die Tugend des Mannes schlechthin.[25]
Der griechische Held ist Ausgangspunkt der Ethik und ihr Orientierungspunkt. Seine ἀρετή, ihr Vorbild, ist Gegenstand ethischer Überlegung. Tugend ist Tugend im Kampf. Sie wird erworben in der „Ertüchtigung“ durch den Wettkampf. Es gilt etwas aus dem zu machen, was man als natürliche Anlagen und kulturelle Herkunft mitbringt. Ausgerichtet an den Vorbildern und im Wettkampf mit anderen wird die eigene Natur gestärkt und die eigenen Schwächen niedergerungen.
In der Entwicklung der ethischen Tugendlehre wurde – z.B. bei Aristoteles – die (ethische)[26] Tugend als die habituelle Tüchtigkeit verstanden, die affektiven Antriebe des eigenen Handelns in einen „richtigen“ Ausgleich zu bringen. „Tapfer“ nennen wir denjenigen, der mit Furcht richtig umzugehen weiß. Tapferkeit ist die richtige Wahrnehmung des Fürchterlichen, also dem, was uns schweren (bis tödlichen) Schaden zufügen kann, und ihm richtig zu begegnen. Sie ist die „Mitte“ zwischen Feigheit und Tollkühnheit, die beide Laster (κακία) sind, weil sie Unvermögen ausdrücken, dem Fürchterlichen richtig entgegenzutreten: der Feige flieht die kleinste Gefahr und verliert sich in der Furcht; der tollkühne Verwegene verkennt die Gefahr und kommt darin um. Beiden Lastern geht die Selbstbeherrschung ab.
Auch hier – noch bei Aristoteles – ist die Ausrichtung am „Helden“ zu spüren. Der Held wird zwar „zivilisiert“ und „demokratisiert“, das Muster des kriegerischen Helden mit seinen „überragenden“ Taten verblasst etwas und er wird der Beurteilung durch die „guten Meinungen“ () übergeben. Die Tapferkeit rückt z.B. gegenüber der Großgesinntheit oder Seelengröße (μεγαλοψυχία) etwas beiseite. Maßstab der ethischen „Ertüchtigung“ und Bewertung bleibt freilich der „edle Mann“ (ἀνὴρ ἀγαθός), an dessen Beispiel zu sehen ist, was gut und richtig ist. Allgemeine Schulregeln reichen dafür nicht hin. Stattdessen verdankt sich Tugend dem Vorbild, Übung und Gewöhnung.
Lasterhaftes Unvermögen
Die Genealogie der Tugenden zeigt zweierlei: die Ethik orientiert sich am „edlen Mann“ (ἀνὴρ ἀγαθός) und das, was ihn „edel und gut“ macht, ist die Tugend (ἀρετή). Sie „gibt“ ihm Kraft und Stärke, genauer bezeichnet sie diese. Ihr „verdankt“ sich (politische) Herrschaft und gelingende Lebensführung.
Tugenden sind Vermögen. Laster dagegen können nichts, sie sind Schlechtigkeiten (κακία) und („sklavische“) Unvermögen. Der Tüchtige kann etwas, was dem Schlechten abgeht. Wir können schwach bleiben, weil wir uns nicht stärken, und schwächer werden, indem wir uns Stärke nehmen. Aber wir können nicht besser werden im Schlechtsein. Wir können uns durch „Ertüchtigung“ (Vorbild, Übung und Gewöhnung) stärken, uns aber nicht zum Unvermögen ertüchtigen. Alles was wir tun, tun wir auf Grund einer uns eigenen Kraft. Aus Schwäche können wir nichts tun und schon gar nichts schaffen.
Grausamkeit ist als „Laster“ jedenfalls ein Unvermögen und nicht zuletzt eines der eigenen Lebensführung– wie Montaigne, Rorty und Seel wohl übereinstimmend meinen. Wir sprechen zwar davon, dass man „Markus nicht unterschätzen“ dürfe, weil er ziemlich grausam sein könne, wie wir eben auch von Kindern sagen, sie können grausam sein, weil sie etwas nicht können. Grausamkeit ist kein Vermögen, so wenig wie Vergesslichkeit oder Geschmacklosigkeit. Es geht einem etwas ab, das man haben sollte.
Grausamkeit ist ein charakterlicher Mangel, ein Fehler, der daraus resultiert, dass einem etwas fehlt. Sie entsteht, weil wir uns „grausames“ Verhalten zur Gewohnheit machen, habitualisieren, und das tun wir, weil wir unsere Stärken nicht stärken. Im Falle der Grausamkeit heißt dies z.B. unsere Empfindsamkeit kultivieren und verfeinern. Das ist nicht etwas, das wir unabhängig von allem anderen tun könnten, so als ginge es darum, den Geschmackssinn für Schimmelkäse zu verfeinern. Kultivierung ist die Kultivierung einer Lebensform, der Form in der wir uns in der Welt wahrnehmen und verhalten. Das ist auch das, was Rorty meinen dürfte, wenn er von der Erweiterung unseres Vokabulars spricht und von den Büchern (Erzählungen und Geschichten), die uns die Wirkungen unseres individuellen und unseres gesellschaftlichen Verhaltens auf leidensfähige Wesen wie wir es sind nachvollziehen lassen.
Am Beispiel grausamer Strafe, unbarmherziger Erziehung oder qualvollem, nicht artgerechten Umgang mit Tieren lässt sich zeigen, wie die als „grausam“ bewertete Handlungen aus Erzählzusammenhängen herausfallen, die sie von harter oder gerechter Strafe, konsequenter Erziehung und unverkünstelter Tierhaltung unterscheiden.

Für die griechische Ethik und das Vorbild des mythischen Helden war Grausamkeit kein (großes) Thema.[27] An Beispielen wie der Häutung des Marsyas durch Apollon zeigt sich, dass auch den Göttern Handlungen zugeschrieben wurden, die uns zutiefst zuwider sind. Die Homersche Ilias ist in großen Teilen ein Gemetzel, auf das die agierenden „Helden“ mit Stolz sehen, obgleich ihnen die Schrecklichkeit des Geschehens bewusst ist. Der Zorn des Achill, der über die Tötung Patroklos durch Hektor, lässt ihn auch in den Augen der Danaer Verabscheuungswürdiges tun. Aber der Zorn kommt schließlich durch die flehentliche Bitte des Priamos zur Ruhe. Anders als Hekabe, seine Frau und Mutter des Hektor, sucht er Versöhnung. Hekabe rät ihm ab, zu Achill zu gehen, „dem ich gern in der Mitte die Leber / tief mich verbeißend, zerfleischte! So würden gerächt seine Taten / Gegen mein Kind“.[28] Priamos sucht keine „grausame Rache“. Er wendet sich – geleitet durch die Götter – an Achill. „Denk an den eigenen Vater, du göttergleicher Pelide / Der , gleich mir , schon steht an der traurigen Schwelle des Alters. / Und es könnte doch sein, daß auch ihn die umringenden Nachbarn / Drängen, doch findet sich keiner, Fluch und Leid ihn zu schützen. / Dennoch aber, sobald er nur hört, du seiest am Leben, / Freut er sich innig im Herzen und hofft von Tage zu Tage, / Endlich den teuersten Sohn aus Troja kommen zu sehen. / Mich aber schlug das Geschick…“[29] Das geht Achill „ans Herz“ (θυμός), trifft das innerste seines Wesens und beschreibt die eigenen Erfahrungen neu. „Ärmster, was hast du doch alles erdulden müssen im Herzen! /… / Komm und setze dich her auf den Sessel; wir wollen vor allem / Ruhen lassen, so traurig wir sind, im Herzen die Sorgen.“[30] Als Sterbliche sind sie beide dem Schicksal unterstellt und können sich als leidenden Wesen erkennen:
„Gar nichts richten wir aus mit unserem schaurigen Jammer
So bestimmten die Götter das Los für die kläglichen Menschen,
Immer in Sorgen zu leben; allein sie selber sind sorglos.“[31]
Das ist die Einsicht, die Grausamkeit aufhebt.
[1] Martin Seel, 111 Tugenden, 111 Laster, Eine philosophische Revue, 2011, S. 248.
[2] Michel de Montaigne, Essais, 3 Bde, 1992, Das XI. Hauptstück, Von der Grausamkeit, I, S. 834ff.
[3] Montaigne, a.a.O., S. 850.
[4] Die Liste der Laster findet sich z.B. bei Diogenes Laertius
[5] Die Liste geht zurück auf Gregor dem Großen (Expositio in Job XXXI, 43, 87)
[6] Judith Shklar, Ordinary Vices, 1984.
[7] R. Rorty, Kontingenz, Ironie und Solidarität, 1992, S. 14.
[8] Rorty, a.a.O., S. 14.
[9] Rorty gibt ihr die weibliche Form, um sie von der „alten“ Vorstellung des Ironikers zu unterscheiden.
[10] Rorty, a.a.O., S. 153.
[11] R. Rorty, a.a.O., S. 153.
[12] Rorty, a.a.O., S. 153.
[13] „Das Gegenteil von Ironie ist gesunder Menschenverstand… Wenn der gesunde Menschenverstand herausgefordert wird“ – wie jetzt hier durch die „ironische“ Einführung des Worts „grausam“ – „reagieren seine Anhänger zunächst nur mit Verallgemeinerung und Verdeutlichung der Regeln des Sprachspiels, das sie zu spielen gewohnt sind …“ – und darin muss ich mich wohl wiedererkennen. (Rorty, a.a.O., S. 128)
[14] Es ist die Vorwegnahme des Genderismus. Der liberale Intellektuelle lebt vom geistreichen Detail, wichtig ist woke.
[15] Rorty, .a.a.O., S. 229.
[16] Rorty, a.a.O., S. 265.
[17] Seel, a.a.O., 8, S. 30.
[18] Für denjenigen, der „grausame Qualen“ erleiden muss, ist es zunächst gleichgültig, ob die Schmerzen absichtlich herbeigeführt wurden oder von einem Unfall herrühren.
[19] Seel, a.a.O., S. 31.
[20] Und das ist der Punkt, den Rorty mit seinem Hinweis auf Bücher machen will, „die uns helfen, weniger grausam zu sein“. Sie helfen uns zum einen „die Wirkungen sozialer Verhaltensweisen und Institutionen“ und „die Wirkungen unserer privaten Idiosynkrasien auf andere zu sehen“ (Rorty, a.a.O., S. 229).
[21] Seel, a.a.O., S. 31.
[22] Sie macht sie zu dem, was wir von ihnen im besten Falle erwarten.
[23] A.a.O., S. 29.
[24] Die Selbstverpflichtung wird nicht zuletzt aus der eigenen Herkunft abgeleitet, der gegenüber man sich zum Besten verpflichtet weiß und dem im Kampf darum gerecht wird. Ilias VI, 208ff.: „Immer der erste zu sein und ausgezeichnet vor andern, / Daß ich der Väter Geschlecht nicht schändete, welches die besten / Helden in Ephyre zeugt’ und im weiten Lykeierlande.“ (αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἳ μέγ‘ ἄριστοι ἔν τ‘ Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ).
[25] Wenn wir z.B. auf Grabtafeln lesen können, „er starb als ἀνὴρ ἀγαθός“, dann soll damit anzeigt werden, dass es sich um einen „tapferer Mann“ handelt, der im Krieg starb.
[26] Im Unterschied zu den dianoetischen, die nicht auf gegenstrebigen Affekten beruhen.
[27] Es findet sich allenfalls in der Verurteilung von Wildheit und Rohheit (ὠμότης, θηριότης), die mit barbarisch-wilden Völkern verbunden wurden. Man graut sich vor menschenfressenden Völkern (ἀνδροφάγοι) und ganz und gar blutrünstigen Barbaren (φονικώτατοι) von denen z.B. Herodot berichtet (Hist. IV). In vielem das Bild der wilden Rohheit ist der Kyklop Polyphem, der (erbarmungslos, νηλής) Odysseus Gefährden verspeist (Od. IX)
[28] Ilias XXIV, 212f: ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι ἐσθέμεναι προσφῦσα· τότ’ ἄντιτα ἔργα γένοιτο παιδὸς ἐμοῦ
[29] Ilias XXIV, 486ff.: μνῆσαι πατρὸς σοῖο θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ, / τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ·/ καὶ μέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες / τείρουσ’, οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι. / ἀλλ’ ἤτοι κεῖνός γε σέθεν ζώοντος ἀκούων / χαίρει τ’ ἐν θυμῷ, ἐπί τ’ ἔλπεται ἤματα πάντα / ὄψεσθαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντα·/ αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος
[30] Ilias XXIV, 518ff.: ἆ δείλ’, ἦ δὴ πολλὰ κάκ’ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν /…/ ἀλλ’ ἄγε δὴ κατ’ ἄρ’ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ’ ἔμπης / ἐν θυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ·
[31] Ilias XXIV, 524ff.: οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο·/ ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι / ζώειν ἀχνυμένοις· αὐτοὶ δέ τ’ ἀκηδέες εἰσί.
[33] Einen eindrucksvollen Überblick gibt Werner Jaeger, Paideia, 1933. Es ist vermittelt über die Ursprünge der Ethik und die Entwicklung des Bildungsbegriffs eine Fülle von Einblicken und Einsichten.