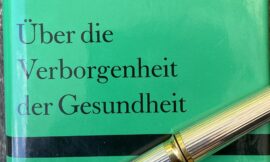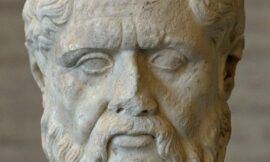Allzuviel ist schlecht gereimt. Dann freilich gibt’s auch „gute Reime“. Peter Rühmkorf (1929-2008) war einer der „Modernen“ der Nachkriegsgeneration, die weiter dem Reim zugeneigt waren und dennoch nicht als komischer Parodist oder wortgewandter Spaßmacher gilt. Im Sommersemester 1980 hat er in Frankfurt im Rahmen einer „Gastdozentur für Poetik“ eine Vorlesung Zur Naturgeschichte des Reims und der menschlichen Anklangsnerven gehalten, die dann 1985 unter dem Titel agar agar – zaurzaurim veröffentlicht wurde. Wer Peter Rühmkorf ein bisschen kennt, weiß, dass eine solche Vorlesung sich von anderen akademischen Vorträgen unterscheiden wird. Hier wird kein dichterischer Tiefsinn zur Schau gestellt. Rühmkorf versteht sich eher als „Reimwerker“ denn als dichterischer Prophet. Peter Rühmkorf wird sagen, dass dem Reim immer ein „Rest von Narretei und Gaukelwesen… anhängt“[1] und fühlt sich darin augenzwinkernd heimisch. Und nicht ohne einen gewissen stolzen Trotz bekennt sich hier einer zum Reim, dem die hohe Kunst der Moderne eher popularisierende Funktion zuschreibt.
Allzuviel ist schlecht gereimt. Dann freilich gibt’s auch „gute Reime“. Peter Rühmkorf (1929-2008) war einer der „Modernen“ der Nachkriegsgeneration, die weiter dem Reim zugeneigt waren und dennoch nicht als komischer Parodist oder wortgewandter Spaßmacher gilt. Im Sommersemester 1980 hat er in Frankfurt im Rahmen einer „Gastdozentur für Poetik“ eine Vorlesung Zur Naturgeschichte des Reims und der menschlichen Anklangsnerven gehalten, die dann 1985 unter dem Titel agar agar – zaurzaurim veröffentlicht wurde. Wer Peter Rühmkorf ein bisschen kennt, weiß, dass eine solche Vorlesung sich von anderen akademischen Vorträgen unterscheiden wird. Hier wird kein dichterischer Tiefsinn zur Schau gestellt. Rühmkorf versteht sich eher als „Reimwerker“ denn als dichterischer Prophet. Peter Rühmkorf wird sagen, dass dem Reim immer ein „Rest von Narretei und Gaukelwesen… anhängt“[1] und fühlt sich darin augenzwinkernd heimisch. Und nicht ohne einen gewissen stolzen Trotz bekennt sich hier einer zum Reim, dem die hohe Kunst der Moderne eher popularisierende Funktion zuschreibt.
„Tatsächlich durchwest der Reim… unseren Konsumentenalltag“[2] und zwar ganz undichterisch. Von dort nimmt Rühmkorf auch seinen Ausgangspunkt, nämlich beim Stabreim oder der Alliteration. Man kann sagen: hier und heute und auf Schritt und Tritt und in Hülle und Fülle begegnet er uns ohne Rast und Ruh. In den Medien kommen bei Tages-Themen oder im Sport-Spiegel nicht nur allerlei Titel Thesen Temperamente, sondern eben auch viel Stab-Gereimtes zum Ausdruck.[3] Was sich reimt, das leimt sich – und kommt einfach besser an.
Wiederholung
Es gibt einen gewissen „Trieb zur Wiederholung“ und der einfachste und nicht gerade hoch geachtete Reim ist die schlichte Wortwiederholung. Sie scheint gelegentlich als gleichsam natürliche Abbildung des Ausgedrückten. Wie nennt sich ein Hund im Deutschen, weil er so „macht“? Richtig, ich meine den „Wau- wau“-Wau-Wau (holländisch: waf waf; griechisch: ghaw ghaw; japanisch: wan wan und französisch: oua oua). Und die wiederholende Verdoppelung gibt auch in piano piano, hopp hopp oder zack zack erst das richtige Verständnis. Von Reiner Kunze stammt ein kleines Gedicht, das Peter Rühmkorf dafür zitiert
DRILL
kere – bitten
kerekere – betteln
(Wörter der Fidschiinsulaner)
Die Sprache der Fidschi, heißt es, zeugt
von niederer Kultur:
sie beruht
auf dem Prinzip der Wiederholung.
Daher, Tochter:
marschmarsch!
Wiederholung ist keine bloße Tautologie, sie ist verstärkende Betonung – „doppelt gemoppelt“ hält besser, eben „durch und durch“.
Ein Mädchen, erzählt Peter Rühmkorf, wird gefragt, welche der Rittersporne ihr am Besten gefallen und sagt schließlich: „Die gefallen mir besser, die sind so schön blau-blau.“[4] Daher auch der Buchtitel agar agar, womit eben ein besonders bekömmlicher agar, nämlich Algenart, bezeichnet wird.
Das mag für manche plemplem klingen, ist aber gar nicht so ballaballa. Es findet sich z.B. auch in der Deutschland Deutschland Hymne oder in der britischen Rule Britania, Britania rule the waves.
Der „Trieb zur Wiederholung“ geht einher mit dem „Rhythmus als Weg [bis] in die religiöse Ekstase“[5]: Was für die einen Ho Ho Ho-tschi-minh war für die anderen zickezacke zickezacke hoi hoi hoi.
Bei letzterem sind wir allerdings schon beim Kloning, oder der Wiederholung, in der sich doch was ändert: nicht nur für Krethi und Plethi und keineswegs HolterdiePolter entsteht schwuppdiwupp doch nicht nur Wirrwarr und Mischmasch, der nicht immer nur Larifari oder Wischiwaschi ist. Obwohl in der leichten Verschiebung sich oft ein Durcheinander ankündigt, das sich zum Tohuwabohu oder Kuddelmuddel auswächst.[6] Und weil es sich gereimt einfach besser verkauft, findet sich sein Einsatz auch bei Blut und Boden Programmen, die für Führer, Volk und Vaterland statt „Grüß Gott“ schließlich mit „Heil Hitler“ grüßen.[7] Aber er gibt nicht nur vorschnelle Zustimmung, er zeigt sich auch gegen Schein und Sein einen kritischen Widerspruchsgeist, zur Eile mit Weile mahnt, wie gewonnen, so zerronnen auch für den Reim gelten kann. [8]
Stabreim, Wiederholung und Kloning geben einen gewissen Zusammenklang, der im Sprechen klingen muss. Man muss es hören und deshalb „laut“ lesen. Reimen folgt einer gewissen „Lust an verbalen Echoeffekten“.[9] Der Reim bringt etwas „auf einen klingenden Nenner“.[10] Und ganz im Sinne der Rede von der adaequatio verbi ad rem spricht Rühmkorf davon, dass „die Sprache bannt und beschwört und bezirzt und flötet und lockt und offensichtlich sich die Finger nach den Dingen leckt“ und die „Poesie… mit ihren rational gewiß nichtmehr zu rechtfertigenden Bindeverfahren“[11] gereimt zusammenleimt.
Und „hinaufgeschaut“
Von der „Froschperspektive“ der Sozial- und Naturgeschichte des Reims geht’s dann erst in den letzten drei Vorlesungen auf den Gipfel der hohen Kunst und der Lyrik. Nicht alles soll sich zu Herz und Schmerz reimen.
Der Reim ist ein „Zusammenhangssimulator“ und er stellt die sinnvolle und sinnerschließende, manchmal auch widerständigen „Zusammenhänge“ durch den Klang her. Das Reimen ist – wie Peter Rühmkorf in unverwechselbarer Weise sagt – ein „Sondergebiet des Klangerzeugungswesens“[12] Reimpaare resonieren, sind „von Sympathie bewegt“ und folgen einem „Gravitationsprinzip der Gegensätze“, das neuen Sinn erzeugt.[13]
Nicht alles reimt sich freilich ungezwungen und manches reimt sich auf nichts. Davon weiß Wolfgang Borcherts (1921-1947) von seiner Fronterfahrung zu berichten: „Wer unter uns, wer denn, ach, wer weiß einen Reim auf das Röcheln einer zerschossenen Lunge, einen Reim auf einen Hinrichtungsschrei…“ Daraus darf man wohl schließen, dass der Reim es doch mehr mit dem harmonisch Guten und symphonisch Schönen als mit dem schlechthin Ungereimten, dem Bösen zu tun hat. Er zeigt, was zusammenstimmt und gar nicht selten auch im „Wi(e)derklang“, was an Ungereimten im Alltäglichen durchklingt und nach stimmiger Auflösung verlangt.
„Spannend reimen“

Ein „Reimwerker“ sollte – wenn es denn überhaupt angebracht ist – „spannend reimen“; die besondere Art der Reimbildung oder -nutzung charakterisiert einen „Reimwerker“, der traditionell Dichter heißt. Und wer zu einem besonderen An- und Zusammenklang der Worte nicht in der Lage ist, der sollte nach Rühmkorf mit der (Sprach-)Kunst aufhören, in der er so kein rechter Meister werden kann.
Natürlich gibt’s bei Peter Rühmkorf auch die „schönen“ Beispiele, Brecht und Heine, Walter von der Vogelweide und … natürlich Benn. Rühmkorf kann auch auf eigene Reime verweisen: Rühmkorf reimt sich aufs „Eigentlichste“ eben nicht nur auf Dorf, sondern zähnebleckend auch in die deutsche Nachkriegsgesellschaft, polymorph und allerliebst ent-verzerrt metamorph.

Ein Meister des Reims war Bertold Brecht. Er verfremdet den Zusammenklang auf seine, ganz brechtsche Weise. Worauf reimt sich „Lenz“, wenn man in den Krieg geworfen wird? Auf „immens“, weil so die Frühlingshochgefühle in uns um sich greifen? Oder doch auf „im Herzen brennts“, angesichts des grausamen Frühlingskriegsgebiets? Bei Brecht findet in der Legende vom toten Soldaten seinen unverwechselbaren Reim:
Und als der Krieg im fünften Lenz
Keinen Ausblick auf Frieden bot
Da zog der Soldat seine Konsequenz
Und starb den Heldentod.

Oder nehmen wir Gottfried Benn, einer der großen Vorbild(n)er Rühmkorfs. Wie reimt man auf „Mensch“? Benn verbindet (leimt) und reimt ihn besonders:
Die schönsten Verse der Menschen
(nun finden Sie mal einen Reim!)
sind die Gottfried Bennschen:
Hirn – lernäischer Leim[14]
Und am Ende geht’s mit dem kühlen Rühmkorf doch noch durch. Sein Lob spricht dann doch auch für Rühmkorf selbst: „Nichts Höheres möchte der Reim, als freudig mit den Ohren gelöffelt und der Seele als ein Lockruf eingeflüstert werden. Und nichts Edleres hat er im Sinn, als den Zusammenklang des tragisch Getrennten, fatal Auseinandergerissenen, umständehalber Zerteilten wenigstens für einige Atemzüge lang als möglich erscheinen zu lassen.“[15]
Faust zum Zweiten
Und dann gibt’s da natürlich noch Goethe – und seinen Faust (- zu meinem ersten Stück siehe hier). Faust wird getrieben durch ein tragisches Verlangen nach dem Glück, das ebenfalls gereimt aufscheint
Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zugrunde gehn!
Der glückliche Augenblick als Ziel ist zugleich sein Ende. Tatsächlich stellt sich solch ein gefährlich-glücklicher Augenblick ein, den er freilich sofort wieder leugnet. Der Augenblick ist ein sprachlicher und er zeigt sich im Reim.
Die Wechselrede der Liebenden
Bei der ersten, echten Begegnung mit Helena – er hatte sie vorher als Vision gesehen und sie hatte ihn mit ihrer Schönheit sofort in den Bann gezogen – kommt es zu diesem Glücksmoment. Faust fällt ihr zu Füßen, doch Helena möchte mit ihm sprechen und einiges von ihm über ein besonderes Sprechen erfahren:
HELENA:
Doch wünscht ich Unterricht, warum die Rede
Des Manns mir seltsam klang, seltsam und freundlich.
Ein Ton scheint sich dem andern zu bequemen,
Und hat ein Wort zum Ohre sich gesellt,
ein andres kommt, dem ersten zu liebkosen.
FAUST:
Gefällt dir schon die Sprechart unsrer Völker,
O so gewiß entzückt auch der Gesang,
Befriedigt Ohr und Sinn im tiefsten Grunde.
Doch ist am sichersten, wir üben’s gleich;
Die Wechselrede lockt es, ruft’s hervor.
HELENA:
So sage denn, wie sprech ich auch so schön?
FAUST: Das ist gar leicht, es muss von Herzen gehn.
Und wenn die Brust von Sehnsucht überfließt,
Man sieht sich um und fragt –
HELENA:
wer mitgenießt.
FAUST:
Nun schaut der Geist nicht vorwärts, nicht zurück,
Die Gegenwart allein –
HELENA:
Ist unser Glück.
FAUST:
Schatz ist sie, Hochgewinn, Besitz und Pfand;
Bestätigung, wer gibt sie?
HELENA:
Meine Hand.
…
Und ich fühle mich so fern und doch so nah
Und sage nur zu gern: Da bin ich! Da!
FAUST:
Ich atme kaum, mir zittert, stockt das Wort;
Es ist ein Traum, verschwunden Tag und Ort.
HELENA:
Ich scheine mir verlebt und doch so neu,
In dich verwebt, dem Unbekannten treu.
FAUST:
Durchgrüble nicht das einzigste Geschick;
Dasein ist Pflicht, und wär’s ein Augenblick.
Reim ist Wechselrede, sich ergänzendes, „liebkosendes“ Zusammen- und zueinanderstimmen. Die Liebe der Figuren drückt sich aus in ihrem Sprechen. Sprache ist dialogische Zuwendung, die es erlaub zwiefältig einstimmig zu werden.„Im Reim drückt sich das Wesen der Sprache selbst aus. Sprechen ist Klang, ist zeitlicher Ablauf, der gerade durch die erwartete Ergänzung ausdrücklich wird. Wir erwarten die Resonanz.[16]
Das Wesen Mensch ist sprachlich, er ist das Wesen, das Sprache hat (ζῷον λόγον ἔχον). Wenn es im Lateinischen dann etwas verkürzend animal rationale heißt, dann weil es „Denken“ als das „Gespräch der Seele mit sich selbst“ nur gibt „seit ein Gespräch wir sind und hören können voneinander“.
„Jedes ausgesprochene Wort erregt den Gegensinn“ hatte Goethe mit Blick auf demonstrative Behauptungen formuliert.[17] „Meinen Sie nicht auch…“ führt meist zum entschiedenen „Nein“ – man lässt sich nicht gerne was unterstellen. Aber auch hier hat das Wort ein Gegenüber, einen Gegensinnigen, und gewinnt erst in diesem gegen-sätzlichen Zusammen seinen Sinn. Sprechen heißt miteinander sprechen, sich im Sprechen aus-tauschen und zusammenkommen. Wie anders, wenn ein Wort die Ergänzung durch den Gesprächspartner nahelegt, es sich von selbst zum gemeinsamen Sinn ergänzt.
„wenn die Brust von Sehnsucht überfließt,
Man sieht sich um und fragt
??? – – – ??? wer mitgenießt.“
Im Reim fügt sich etwas klingend zusammen, was sich doch unterscheidet. Vermutlich liegt im Dialogischen des Sprechens auch der „Trieb zur Wiederholung“ begründet: auf blau oder agar antwortet mir alle Welt mit blau und agar und das Blaue wird blau blau und der gute agar agar agar. „Was der Reim verbindet, … das scheint zurecht verbunden.“ Im Faust sind es Frau und Mann, Faust und Helena. Walter Muschg hatte vom Reim als Vom magischen Ursprung der Dichtung (1933) gesprochen und es müsste wohl heißen der Sprache[18]
[1] A.a.O., S. 131.
[2] P. Rühmkorf, agar agar – zaurzaurim, Zur Naturgeschichte des Reims und der menschlichen Anklangnerven, 1985, S. 21.
[3] Schön auch die „Mainzelmännchen“, die nicht von den „Montags-Malern“ stammen und nicht in „Bios Bahnhof“ auftreten
[4] A.a.O., S. 75.
[5] A.a.O., S. 83.
[6] Das zeigen auch: Remmidemmi, Rambazamba, Hokuspokus, Techtelmechtel. Papperlapapp.
[7] Peter Rühmkorf lässt sich’s nicht nehmen, den Witz zu erzählen, ein mit HH gegrüßter hätte geantwortet: „Mach du’s doch. Ich bin kein Arzt.“
[8] A.a.O., S. 41.
[9] A.a.O., S. 43.
[10] A.a.O., S. 35.
[11] A.a.O., S. 74.
[12] A.a.O., S. 142.
[13] A.a.O., S. 148.
[14] Heinrich Heine, auch ein Verehrter der Liebhaber von Dichtung und Reim, hatte ihn auf abendländisch klingen lassen: „Fehlt etwa einer im Triumvat, / So nehmt einen andern Menschen, / Ersetzt den König des Morgenlands / Durch einen abendländschen.“ (Wintermärchen, Caput IV). Heinrich Heine weiß auch gut wonach Deutschland klingt: „Zu Celle im Zuchthaus sah ich nur / Hannoveraner – O Deutsche! / Uns fehlt ein Nationalzuchthaus / Und eine gemeinsame Peitsche.“
[15] A.a.O., S. 135.
[16] Ganz im Sinne des wunderbaren Ansatzes von Hartmut Rosa, Resonanz, Eine Soziologie der Weltbeziehung, 2016. Eine unbedingte Leseempfehlung.
[17] Wahlverwandtschaften, 2. Teil, Kap. 4.
[18] A.a.O., S. 83.