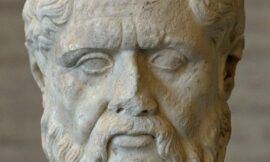„Worüber lachst Du?“ – darauf gibt es keine rechte Antwort. Wer einen Witz nicht versteht, dem ist er auch nicht zu erklären ohne ihn „witzlos“ zu machen. Wer nicht mitlachen kann, der steht irgendwie daneben, sieht sich ausgeschlossen. Er teilt das Selbstverständliche nicht, auf dem der Witz beruht. Manchmal steht man nur auf der Leitung, manchmal findet man es einfach nicht witzig. Immer bleibt, man ist jetzt anders als die andern, wir verstehen uns nicht von selbst.
Der Lachende ist in kaum besserer Lage: wir lachen über etwas oder jemanden und wissen doch selten genau worüber – und eigentlich fast nie warum. Erklären wir unser Lachen, verschwindet es – wir wissen dann gerade nicht zu sagen, was daran so lustig sein soll. Wer das Lachen erklären will, wird selbst lächerlich. „Ich musste so lachen“. Und was muss, muss.
Wer mitlacht, muss aber den Witz nicht verstanden haben. Es gibt Kollegen, die so ansteckend lachen, dass uns der Sinn nicht danach steht, nach dem Sinn zu fragen: wir werden einfach mitgerissen ohne zu wissen, worum es geht. „Ich musste einfach lachen“ Die Situation war so – ich war so.
Freilich will Lachen gelernt sein. Über stolpernde Clowns lachen wir, über Behinderte nicht. Es gibt Dinge, über die lacht man nicht. Das bringen wir unseren Kindern bei. Wer dennoch über Dinge lacht, die andere nicht lustig finden, zeigt dass sie einiges trennt. Es gibt Witze, über die können eben nur „Philosophen“ lachen:
In der mündlichen Abschlussprüfung beruhigt der Professor den Studenten: „Kein Grund zur Aufregung. Wir fangen mal ganz einfach an: Sagen Sie uns doch mal, wie lautet der berühmte Satz des Protagoras?“ – „a2 + b2 = c2. – Soll ich das beweisen?“.
Wenn wir nicht mit ihnen, dann können wir doch über sie lachen. Die thrakische Magd lacht jedenfalls über den Philosophen, der den Kopf nach oben und den himmlischen Sternen zugewandt in die irdene Grube fällt. Der große Geist ist also schlicht ein Tollpatsch.
Kulturgeschichte des Lachens/dichte Beschreibung
Andere lachen anders. Und wer nicht lacht, wo wir lachen, ist anders als wir. Und andere lachen über Dinge, die uns gar nicht komisch vorkommen, mit denen es uns ernst, manchmal todernst ist.
„Ich musste einfach lachen“ und „Darüber kann ich nicht lachen“ – das sagt viel über uns aus. Worüber wir lachen können und worüber nicht, das greift über das ausdrückliche Wissen hinaus. Um zu wissen, was uns ausmacht, brauchen wir andere Perspektiven, wir brauchen Andere, die anders sind und uns zeigen, dass wir es auch sind und worin.
Freilich bedarf es eines ähnlichen Zugangs. Außerirdisches Lachen könnten wir wohl als Lachen gar nicht erkennen. Und was täten wir mit Außerirdischen, die gar nicht wüssten, was es heißt zu lachen? Andere Kulturen müssen also anders, dürfen aber nicht ganz anders sein.

Das ist nicht zuletzt ein Grund, warum Mary Beard mit dem „Das Lachen im alten Rom. Eine Kulturgeschichte“ (dt. 2016) beschäftigt. Neben großen Studien zu Pompeji (Pompeii: The Life of a Roman Town, 2009; dt.: 2017), zur Geschichte Roms (SPQR: A History of Ancient Rome, 2015; dt.: 2016) und einer beeindruckenden Fernsehproduktion in drei Teilen, nun also etwas übers Lachen. Mary Beard bezieht sich auf ein „Manifest für eine Geschichte des Lachens“, nämlich einen Vortrag von Keith Thomas über das Lachen zur Zeit der Tudors und Stuarts in England. Es geht um die „Einsicht in die wechselnden menschlichen Gefühlswelten“ und eine „bessere und ‚dichtere‘ Beschreibung einer vergangenen Gesellschaft“, wie sie bereits in den 1930er Jahren Michael Bachtin über Rabelais und seine Welt versucht hatte.
Wenn wir „Lachen im alten Rom“ suchen, was suchen wir da? Haben sie denn überhaupt gelacht? Wir werden sehen, dass das beim Lächeln nicht der Fall zu sein scheint. Natürlich haben die Römer gelacht. Wie konnten sie nicht. Es waren ja Menschen und Menschen lachen – auch wenn wir nicht genau wissen, was Lachen eigentlich ist und es dazu durchaus recht unterschiedliche Vorstellungen gibt.
Theorien zum Lachen
Es gibt im Wesentlichen drei Theorien zum Lachen, die jeweils an bestimmten Phänomenen, die mit dem Lachen verbunden werden ansetzen und sie unterschiedlich gewichten.
Wir Lachen meist über etwas, das unsere Erwartung auf vergnügliche Weise durchkreuzt: ein Wortwitz kehrt die Bedeutung eines Worts hervor, die wir in der Sprechsituation nicht intendiert hatten. Der Kunde antwortet auf die Frage seines Friseurs, wie er die Haare geschnitten bekommen möchte: „Schweigend.“ Oder die Schuhe des Clowns sind „lächerlich“ groß und natürlich fällt er bei seinem Versuch elegant über die Bühne zu schreiten tollpatschig über die eigenen Beine. Die sogenannte Inkongruenz-Theorie (sammelt hinter sich wohl die Mehrzahl der großen Namen) versteht das Lachen als ein Lachen über etwas, das nicht zusammenpasst und vergnüglich zusammengestellt wird.
Was wir Lächerlich finden, dem fühlen wir uns überlegen. Lachen ist nicht selten ein Auslachen oder gar ein Verlachen. Der Lachende setzt sich von dem ab, was so alles im Leben passieren kann, versöhnt sich mit ihm, indem er das Lächerliche ausgrenzt. Das Lächerliche der Inkongruenz wird verlacht und für sich selbst unschädlich gemacht. Das Lachen stärkt die eigene Perspektive, sagt die Überlegenheitstheorie (z.B. Thomas Hobbes). Das Lächerliche der andern versichert die ernsten Absichten der eigenen Lage.
Lachen ist gesund, sagt dagegen die Erleichtungstheorie. Es baut Spannungen ab, die durch die Zweideutigkeiten und lächerlichen Inkongruenzen entstehen. Lachen erleichtert vom gesellschaftlichen Druck der Konformität und der verpflichtenden Eindeutigkeit. Die Erleichterungstheorie versteht man wohl am besten, wenn man weiß, dass Sigmund Freud sie vertreten hat.
Daran zeigt Mary Beards kein großes Interesse. Es geht ihr nicht um ein künstlich Allgemeines, sondern um die römische Besonderheit. Die drei Theorien „können brauchbare Werkzeuge sein. Sie schaffen etwas Ordnung in der komplizierten Geschichte der Spekulationen über das Lachen“, aber aus der Sicht Mary Beards schaffen sie „lauter [neue] Probleme“ statt sie zu lösen.
Das Lachen über Witze ist doch etwas anderes als das durch Kitzeln hervorgerufene. Das „domestizierte Lachen“, das über soziale Regeln die zwischenmenschliche Kommunikation trägt ist etwas anderes als das spontane und unkontrollierbare Lachen, das eher dem Niesen gleicht. Mary Beard schließt daraus, „dass eine Theorie umso weniger plausibel ist, je mehr Varianten von Lachen sie zu erklären versucht. Keine Behauptung, die mit den Worten ‚Jedes Lachen …‘ beginnt, ist jemals wahr und nicht zugleich banal“. Mary Beard bringt gegen die Eindeutigkeit und Ausschließlichkeit der Theorien gewichtige Argumente vor. Insbesondere sieht sie zwischen den Theorien und den von ihnen herangezogenen Phänomenen vielerlei Übergänge. Das scheint ihr gegen die Theorien zu sprechen.
Lachen in Texten
Mary Beard fragt nicht „Warum lachen wir?“ oder „Warum lachst Du?“, sondern „Worüber lachst Du, Römer?“ Die Besonderheit des „römischen Lachens“ soll – so unterstelle ich – einen Zugang zur Besonderheit der römischen Gesellschaft geben und uns damit etwas über uns und unser Lachen entdecken.
Die Sache ist nicht einfach. Wir suchen also Witze, die wir nicht verstehen?! Wie können wir die finden, wenn wir sie gerade nicht als Witz erkennen? In direkter Begegnung erleben wir, dass andere über etwas lachen, das uns gar nicht komisch vorkommt. Wie wissen wir aber, worüber die Römer gelacht haben.
Im Wesentlichen müssen wir uns auf Texte verlassen. Da gibt es z.B. Texte, die geradezu dafür gemacht sind, Lachen auszulösen. „Ich will dir, lieber Leser in diesem melesischen Märchen allerhand lustige Schwänke erzählen.“ So beginnen die „Metamorphosen“ des Apuleius (im 2. Jahrhundert), die später auch unter dem Titel „Der goldene Esel“ bekannt wurden. Sie erzählen die verwirrende Geschichte von der Ver- und Rückverwandlung des Erzählers und Romanhelden Lucius in einen Esel. Der Erzähler, im griechischen Attika aufgewachsen, bezeichnet sich „als Ausländer“, der deshalb „hin und wieder in dieser fremden Sprache Fehler begehe. Ich bediene mich derselben nur, weil etwas Kauderwelsch dem Komischen des Stoffes um so mehr aufhilft und deine Belustigung allein mein Zweck ist. Das Märchen ist übrigens eine Geschichte nach zweideutig griechischem Muster. Jetzt beginnt es. Merke auf, es wird zu lachen geben.“
Wir Heutigen freilich, tun uns damit nicht leicht. Und so gibt es z.B. eine intensive Debatte, worum es bei Apuleius eigentlich geht. Einfach lachen is’ nicht!
Natürlich gibt es die Komödien, die es ja ausdrücklich mit dem Lächerlichen zu tun haben. Mary Beard untersucht sie intensiv und mit großer und beeindruckend gelehrter Meisterschaft. Komödien lösen nicht nur im Publikum Lachen aus, gelegentlich wird in ihnen auch selbst gelacht, nämlich von den Figuren des Stücks auf der Bühne. Im Eunuchus von Publius Terentius Afer, Terenz genannt, aus dem Jahr 161 v. Chr, findet sich z.B. folgender Dialog:
Thraso: Mit mir auf dem Gelage war dieser junge Rhodier, von dem ich dir erzählt habe. Zu der Zeit hatte ich gerade ein Schätzchen im Schlepptau. Da beginnt der, Anspielungen zu machen und mich zu verhöhnen. ‚Was‘ antworte ich dem Typen, ‚sagst du da, Unverschämter? Selbst bist du ein Hase und verlangst nach Fleischstückchen“‘?
Gnatho: Hahahae!
Thraso: Was ist los?
Gnatho: Witzig, leichthin, köstlich. Da geht nichts drüber. Aber sag, hast Du den Witz erfunden?
Hier wurde in der Szene gelacht. Hat darüber auch das Publikum gelacht und wenn ja, worüber? Was daran zum Lachen sein soll, erschließt sich uns ja nicht sofort. Mary Beard interpretiert diesen und viele andere Texte mit großer Eleganz. Aber natürlich wird hier nichts verraten. Man kann es bei Mary Beard nachlesen und mit ihr dazu noch ein paar hundert Jahre zurück zu den Griechen gehen.
Vor allem aber zeigt sie, was geleistet werden muss, wenn wir dem „alten Rom“ etwas abgewinnen wollen. Wir müssen uns dem Fremden, das doch ein Teil der eigenen (europäischen) Geschichte ist, in einer „toten Sprache“ nähern, also durch Texte deren Überlieferung keineswegs so bruchlos ist, wie wir es „aus der Distanz“ glauben möchten. Schwierig genug, „lebende Sprachen“ zu übersetzen (was genau bezeichnet common sense oder esprit, Gemüt oder Pflicht?). Wenn wir verstehen wollen, was ein Wort einer toten Sprache in seinem Gebrauch bedeutet, können wir nur Texte befragen und seine Bedeutung über seine Verwendung erschließen.
Im Englischen (ähnlich dem Deutschen) gibt es viele Ausdrücke, die für (Formen von) Lachen stehen: natürlich laugh, aber auch chuckle, giggle, snigger, howl, guffaw oder crack up und es gibt grin, beam, smile und ähnliches. Das Lateinische ist dagegen beim Lachen sparsam, fast geizig: es gibt eigentlich nur ridere und Komposita davon (z.B. adridere, deridere, irridere). Besonders auffällig aber ist, dass die Römer kein eigenes Wort für lächeln haben. Lächelten Römer nicht? Oder galt ihnen das Lächeln nur als eine privative Form des (echten) Lachens, als ein subridere?
Die Herausforderung des Übersetzens ist bei Witzen besonders groß, weil es sich dort z.B. nicht selten um Wortspiele, Übertragungen oder gar falsches Wortverständnis oder Ausdrucksfehler handelt. Die Texte, die wir zur Verfügung haben, blicken auf eine lange Überlieferungsgeschichte. Sie sind zu uns gekommen in Abschriften, die sich regelmäßig in wichtigen Punkten unterscheiden. Es gibt dabei offensichtliche Fehler, so wenn iocus (Witz) in den handschriftlichen Kopien von Ciceros De oratore zu locus (Ort) wird. Aber es gibt andere und nicht wenige Fälle, in denen die kritische Rekonstruktion des Textes lange nicht so offensichtlich ist. Mary Beard führt ein Beispiel aus Quintillians Institutio oratoria an, wo von einer Gerichtsverhandlung berichtet wird und es heute (gemeinhin) so zu lesen ist:
„Als Hispo ziemlich haarsträubender Verbrechen angeklagt wurde, sagte er zu seinem Ankläger: ‚Beurteilst Du mich nach deinen Standards?‘ “
(ut Hispo obicienti atrociora crimina accusatori, me ex te metiris?)
Tatsächlich ist dieser Text „das Ergebnis harter Arbeit moderner Wissenschaftler“, denn die Handschriften kopierten anders. Statt atrociora hieß es dort arbore (Baum) und metiris ist an die Stelle von mentis getreten („das vielleicht eine Form von mentiri … sein sollte … allerdings einen hoffnungslosen Grammatikfehler darstellen würde“). Vor allem aber steht das me ex te überhaupt nicht im Original! Es wurde hinzugefügt, um den (vermuteten) Sinn verständlich zu machen. Allerdings ist die Stelle mit den Korrekturen immer noch ziemlich „witzlos“.
Ein radikal anderer Vorschlag ersetzt nur ein Wort, nämlich arbore durch barbare (in barbarischer Weise) und kommt zu einer völlig anderen, jetzt durchaus witzigen Empfehlung:
„Als Hispo in einer durch Barbarismus entstellten Sprache angeklagt wurde, sagte er zu seinem Ankläger: ‚Du lügen!‘ “
(ut Hispo obicienti barbare crimina accusatori, mentis)
Mentis wäre dann eine absichtlich falsche Form, die den Ankläger lächerlich machen soll, weil dieser nicht mal ordentliches Latein zu sprechen vermag. Wer will jetzt entscheiden, welche Fassung die richtige ist?
Wenn wir einen Witz nicht verstehen, sind wir geneigt, die Überlieferung zu korrigieren und Lesarten zu befürworten, die den Witz für uns witzig machen. Damit gefährden wir genau das, was wir gewinnen wollten, nämlich die Besonderheit des „römischen“ Witzes.
Auch andere „Selbstverständlichkeiten“ lösen sich unter dem kritischen Blick Mary Beards auf. Die Saturnalia, ein religiöses Fest zu Ehren Saturns, gelten gemeinhin als der Proto-Karneval, in dem sich die Ordnungen für ein gewisse Zeit umkehren, Herr und Sklave spielerisch die Rollen tauschen, bei großen rauschhaften Festgelagen allgemeines (breites Volks-) Vergnügen herrscht. Für eine Kultur des Lachens also ein wichtiges Ereignis. Mary Beard zeigt dagegen, dass es dafür „viel weniger antike Beweise als gemeinhin angenommen“ gibt: „Die Ansicht zum Beispiel, Sklaven hätten während der Saturnalia den Haushalt geführt, resultieren aus einer recht eigenwilligen Interpretation eines einzigen Satzes von Seneca …“
Texte über’s Lachen

Es gibt freilich Texte, die vergleichsweise gut tradiert wurden und ausdrücklich vom Lachen handeln. Insbesondere in den klassischen Werken zur Rhetorik von Cicero und Quintilian ist einiges über die römische Sicht aufs Lachen zu erfahren. In Ciceros De oratore, einem großangelegten Dialog über die Kunst des guten Redners wird im zweiten Buch das Lachen besprochen. Für Mary Beard ist Cicero „der hinterhältigste Sprücheklopfer, Wortakrobat und Witzereißer in der klassischen Antike“ und in Plutarchs Doppelbiographie zu Demosthenes und Cicero wird der witzige und lachende Cicero dem ernsthaften und etwas verdrießlichen Demosthenes entgegengestellt. Cicero sei dem Lachen zugetan gewesen und im „Lachen heimisch“ (γέλωτος οἰκεῖος).
Die Rhetorik behandelt das Lachen, weil das Lachen fürs Reden von großem Gewinn ist. Die Rhetorik unterscheidet seit Aristoteles drei Überzeugungsmittel, die ein Redner für seine Sache nutzen kann:
- der Redner kann die Sache selbst begründen und durch ihre vernünftige Darstellung in der Rede nachvollziehbar machen (λόγος),
- er kann die Gefühle und Emotionen der Zuhörer ansprechen, sie in die richtige Stimmung versetzen und damit zur Zu-Stimmung bewegen (πάθος) oder
- er kann durch sich selbst für seine Sache gewinnen, durch seinen Charakter und seine Glaubwürdigkeit überzeugt (ᾖθος).
Dem folgt Cicero weitgehend in De oratore. So wird im zweiten Buch nach der Erörterung der argumentativen Kraft der Rede die Rolle der Affekte untersucht: „Denn nichts ist ja beim Reden wesentlicher, … als dass der Zuhörer dem Redner gewogen ist und dass er selbst so tief beeindruckt ist, dass er sich mehr durch den Drang seines Herzens und einen inneren Aufruhr als durch sein Urteil und seine Einsicht lenken lässt. Die Menschen entscheiden ja viel mehr aus Hass oder aus Liebe, Begierde oder Zorn, Schmerz oder Freude, Hoffnung oder Furcht …“
Ganz ähnlich bringt Lachen die Zuhörer in eine Stimmung, die für den Redner nützlich sein kann. Lachen schafft Heiterkeit und gute Laune (hilaritas) und auch bei Prozessen (und ernsten Angelegenheiten) „ist mit Humor und Witz viel auszurichten“. Lachen bricht „plötzlich hervor“, „es ergreift dabei den Körper, den Mund, die Adern, die Augen, die Miene“ und wir können (manchmal) nur schwer an uns halten. Wer „Lachen macht“, verschafft sich Macht.
Von einer philosophischen Wesensbestimmung des Lachens wird in De oratore ganz im Sinne von Mary Beards Theorie-Skepsis Abstand genommen: „Was das Lachen an und für sich ist, … wo es sitzt, wie es entsteht und so plötzlich hervorbricht, dass wir den Wunsch haben, nicht an uns halten zu können, und wie es zugleich den Körper, den Menschen, die Adern, die Augen, die Miene ergreift, so mag Demokrit sich darum kümmern.“
Demokrit galt als der „lachende Philosoph“ und mit einem ironischen Augenzwinkern werden ihm diese grundlegenden, „ernsten“ Fragen zugedacht. Für den weiteren Fortgang der Überlegungen tut dies nichts zur Sache, „denn diese Frage hat nichts mit unserem Gespräch zu tun …“, für den nur die Frage interessiert, wie das Lachen rhetorisch für die eigenen Zwecke zu nutzen ist.
Scurra
Die eigentliche Herausforderung ist dabei nicht, Lachen beim Publikum auszulösen, sondern es so zu tun, dass es den eigenen Zwecken dient. Für das Hervorrufen von Lachen gibt es (im alten Rom) ein einfaches Mittel: das überzeichnete Imitieren von Schwächen anderer, ihrer Ticks und Fehler, ihrer Behinderungen und Entstellungen. Es ist die Aufgabe von Clowns, Possenreißern und Witzbolden, die als „scurra“ (oder „mimus“) in der römischen Gesellschaft eine feste Rolle spielen. Sie sind im kaiserlichen Palast genauso zu finden wie in den reichen Bürgerhäusern. Sie verdienen sich ihren Lebensunterhalt als „Lacher-Macher“.
Der Witz wird ein Lebensmittel. Um erfolgreich zu sein, bedienen sich die scurrae immer wiederkehrender Formen. Witzige Bewegungsmuster und Slapstickeinlagen werden perfektioniert und professionell inszeniert; Witze, die erfolgreich waren, werden aufgeschrieben und wiederverwendet. Es entstehen Witz-Bücher wie die aus 260 Witzen bestehende Sammlung des Philogelos, des „Lach-Liebhabers“. Und Mary Beard sieht darin nicht zuletzt einen Hinweis, „dass es ‚die Römer‘ waren, die ‚den Witz‘ erfanden“.
Der scurra bringt aber nicht nur Witziges vor, er gibt sich selbst dem Gelächter preis. Seine Rolle ist, dass man über ihn und nicht über seine Witze lacht. Der scurra überzeichnet z.B. in der Imitation anderer so stark, dass nicht (nur und vor allem) über sie, sondern über ihn gelacht wird. Und er gibt nicht nur zu lachen, er lacht auch über die Witze der anderen, insbesondere der zahlenden Herren – oder gibt zumindest vor, es zu tun. Das ist nicht ungefährlich. Ridiculus hat einen gefährlichen Doppelsinn: der homo riduculus ist der witzige und amüsante Mann, aber eben auch der lächerliche. Der (zahlende) Herr will gerne das eine sein, keinesfalls aber das andere. Nur sieht man es dem Lachen nicht an. „Worüber lachst Du?“ ist deshalb im kaiserlichen Rom eine gefährliche Frage. Wer statt über den Witz über den Witzeerzähler lacht, der macht ihn selbst zu einem scurra, setzt ihn herab und verhöhnt ihn. Wenn jemand gezwungen ist, über etwas zu lachen, was gar nicht witzig ist, lacht er tatsächlich über den, der sich mit so witzlosen Witzen selbst zur lächerlichen Figur macht. Und das kann schnell den Kopf kosten.
Der scurra macht sich also zum Affen und aus sich einen Esel. Die Esel sind immer die anderen, die, über die man lacht (siehe Apuleius). Vor allem aber Affen bringen Römer offenbar zum Lachen. Der Affe ähnelt dem Menschen und scheint ihn auf tollpatschige und lächerliche Weise zu imitieren. Er scheint menschliche Handlungen nachvollziehen zu wollen, ohne dass es ihm wirklich gelingt. Der Römer sieht in ihm das ständige Scheitern, etwas sein zu wollen, was er nicht ist. Seine Natur ist witzig und lächerlich ohne doch dem Lachen zugänglich zu sein.
Home ridens

Das Lachen ist eine Eigentümlichkeit des Menschen. Nach von Aristoteles herrührenden Formel ist der Mensch „das lachende Lebewesen“, homo ridens: der Mensch sei – so sagt er in De partibus animalium – das einzige Lebewesen, das lacht (τὸ μόνον γελᾶν τῶν ζῴων ἄνθρωπον. Das Lachen zeichnet den Menschen aus, macht ihn aber nicht zum Menschen. Die Philosophie unterscheidet zwischen dem Wesen und einem Proprium (ἴδιον), eine Eigenschaft, die mit etwas (notwendig) einhergeht ohne das Wesen (hinreichend) zu bestimmen. Der Mensch ist das „vernünftige Lebewesen“ (ζῷον λόγον ἔχον) und als solches ist es gegebenenfalls dadurch ausgezeichnet, Lachen zu können.
Bei Aristoteles geht es an der Stelle in De partibus animalium nicht um das, was der Mensch ist, sondern um das, was Lebewesen im Allgemeinen ausmacht. Als ein organisches Ganzes ist das Lebewesen ein Zusammenspiel von Organen (Teilen), das er nun im Einzelnen untersucht. Nachdem er Herz, Lunge, Leber, Milz und Nieren beschrieben hat, kommt er zum Zwerchfell. Es trennt nach Aristoteles die oberen (höheren) Organe von den unteren (niederen) und regelt den Wärmeaustausch zwischen ihnen. Und das Zwerchfell (διάζωμα) ist dasjenige Organ, das beim Lachen gereizt wird. Es ist also die Grenze (der Gürtel), die die höheren seelischen Leistungen schützt. Sein Beispiel ist das Kitzeln. Durch die dünne Haut des Menschen und durch den Umstand, dass nur der Mensch zum Lachen fähig ist, ist der Mensch kitzlig (z.B. und vor allem unter den Achseln). Man könnte also auch sagen: der Mensch ist das kitzlige Wesen!
Es geht also um die Frage, wie ein auszeichnendes Merkmal (sein Proprium) aus dem verstanden werden kann, was es ausmacht (seinem Wesen). Das Proprium ist nicht das organisierende Prinzip, das etwas zu dem macht, was es ist. Menschen handeln (und verhalten sich nicht nur), weil sie Vernunft haben, nicht weil sie kitzlig sind. Das Lachen-Können, das den Menschen auszeichnet ist vielleicht ebenso abhängig von seinem Sprechen-Können wie das Handeln. Wenn wir nach dem Lachen mit Blick auf das fragen, was den Menschen ausmacht, dann interessiert uns nicht nur die sortale Identifikation.
Was Aristoteles also in De partibus animalium beschreibt, ist die körperliche Bedingung, zu lachen, wie und womit wir lachen, nicht aber warum und worüber. Wir lachen mit dem Zwerchfell, aber wir lachen über etwas – andere über anderes. Wir lachen mit dem Zwerchfell über etwas „Lächerliches“ und lächerlich wäre es, den Grund des Lachens im Zwerchfell zu sehen. Was das Lachen ist, können wir so wenig aus dem Zwerchfell schließen, wie das Wesen des Menschen aus dem Umstand, dass er lachen kann. Und dass wir lachen können, heißt eben noch nicht, dass wir es tun.
Kultur des Lachens
Der Mensch ist das Lebewesen, das Sprache hat (ζῷον λόγον ἔχον) und als solches ein „politisches“ Wesen ist (ζῷον πολιτικόν), ein Lebewesen, das sich über sich und seine Welt miteinander verständigt und sein Leben in Gemeinschaft führt.
Und der Mensch ist einer, der von Natur lachen kann und er kann es als einer, der sein Leben führen und sich zu seiner Natur verhalten kann. Lachen hat zwar etwas Eruptives. Es bricht aus uns heraus und manchmal lässt es sich nur schwer bändigen oder unterdrücken. Jeder kennt die Situation in einer durchaus ernsten Situation plötzlich lachen zu müssen und das eigene Lachen nur schwer unter Kontrolle bringen zu können. Aber er kann sein Lachen kultivieren. Sein Lachen ist als das eines „politisches“ Wesen eigentlich immer schon mehr oder weniger kultiviert. In der Philosophie findet sich deshalb schon früh der Rat, sich vor heftigem Lachen zu hüten. Der Mensch nämlich „hat“ seine Natur und kann mir ihr umgehen. Er kann so und anders lachen. Er kann über die Obzönitäten des scurra lachen und/oder über den „gepflegten“ Witz des gewitzten Redners. Er lacht als Mensch und das heißt als „politisches“ Wesen, als Mensch, der als „geselliges Wesen“ immer schon in einer Gemeinschaft mit anderen lebt. Und das ist auch der Grund, dass wir über Dinge nicht lachen können, über die andere lachen und umgekehrt.
„Worüber lachst Du?“ – das ist auch die Frage, ob der Witz oder die Person gemeint ist, die den Witz erzählt. Ist das Lachen ein Lachen oder ein Aus- oder Verlachen. Lachen wir über den Witz oder den Witzbold?
Tatsächlich ist das Hervorrufen des Lachens von dieser Doppeldeutigkeit begleitet. Der Redner möchte das Publikum für sich gewinnen und will als „witzig und amüsant“ und schlagfertig und geistreich gelten. Das Publikum muss ihn und seine Sache freilich ernst nehmen. Zu lachen ist über andere. Er darf nicht selbst Gegenstand des Lachens werden. Er muss Mitlachender sein. Das Lächerliche ist nämlich durch einen Makel ausgezeichnet, es weicht in irgendeiner Weise von der Idealform ab und ist „unförmig“. In der Antike ist hier sogar meist von Hässlichkeit und Missgestalt (turpitudo et deformitatis) die Rede (wie z.B. bei Cicero) oder von Unvernünftigem und Schlechtem bei Plato (ἄφρον καὶ κακόν) oder von Fehlern bei Aristoteles (ἁμάρτημα τι καὶ αἶσχος). Platon warnt, nicht selbst lächerlich zu werden, wenn man Lachen bewirkt, indem man Lächerliches.
Der Redner muss dafür Sorge tragen, dass er das Lachen nutzt und nicht zum Gegenstand des Gelächters wird. Dass „Witz und Humor (iocus et facetiae)“ für den Redner „gewinnend und besonders nützlich sind“ steht außer Frage. Er muss sich aber „sorgfältig vor der Witzelei des Spassmachers hüten“ und alles vermeiden, was vom Ernst seiner Sache abführt. Er darf nicht den Eindruck erwecken, als sei seine Rede nur ein scurra Stück, zusammengefügt aus Lehrstücken und vorgefertigten Witzeleien.
Den wahren Meister zeichnen geistreiche Witze und Wortspiele, Vergleiche und Anspielungen, für die gibt es „kein System“ gibt (esse nullam artem salis), aus dem man sie zusammenstückeln könnte. Die Stärke des einen rührt vermutlich sogar aus der Schwäche des anderen. Je weniger künstlich eine Wirkung ist desto verlässlicher wirkt sie. Witze erregen schnell den Verdacht, angelernt und unangebracht zu sein. Der Witz verselbständigt sich schnell und es ist für einen (ungeübten) Redner „leichter eine Flamme in seinem brennenden Mund [zu] unterdrücken, als gute Sprüche für sich zu behalten“.
Auch Cicero unterlag wohl immer wieder dem Laster, den guten Witz über die Sache zu stellen. Plutarch berichtet, dass Cato ihn anlässlich einer witzelnden Rede einen „spaßigen Konsul“ (γελοῖον ὕπατον) genannt habe. Das kann im Lateinischen in dem erörterten Doppelsinn zu „ridiculus consul“ werden; Cato hatte aber vor allem vermutlich den scurra im Sinne, der von Plutarch nicht anders als durch „spaßig“ ausgedrückt werden konnte. Cicero also in der Gefahr, als Witzbold zu gelten?!
Vir bonus
Dem scurra haftet ein fundamentaler Mangel an. Er isoliert die affektive Wirkung des Lachens von der überzeugenden Wirkung für die rechte Sache. Dem scurra zu folgen, hieße das Überzeugungsmittel des pathos von den beiden anderen abzuspalten. Dagegen „konzentriert sich die gesamte Redekunst auf drei Faktoren, die der Überzeugung dienen: den Beweis der Wahrheit dessen, was wir vertreten, den Gewinn der Sympathie unseres Publikums und die Beeinflussung seiner Gefühle im Sinne dessen, was der Fall erfordert.“
Der gute Redner ist einer der überzeugt. Er überzeugt vor allem durch sich und seine Lebensführung, die sich in seiner Rede ausdrückt. Er steht für das Richtige, ist ein vir bonus, ein „Mann des Guten“. „Gewinnen aber lassen sich die Herzen durch die Würde eines Menschen, seine Taten und das Urteil über seine Lebensführung.“
Was der Redner auslösen möchte, muss er selbst erleben: „darum … unterweise ich … euch in der Kunst, beim Reden Zorn und Schmerz zu fühlen und Tränen zu vergiessen“.
Von den drei Überzeugungsmitteln, der sachlichen Richtigkeit und der Vernünftigkeit der Rede (λόγος) und ihrer stimmigen Kraft, die Hörer zu einer wirkliche Zu-Stimmung und das heißt tätige Bewegtheit zu bringen (πάθος), ist der Charakter des Redners (ᾖθος) dasjenige, das „so ziemlich die bedeutendste Überzeugungskraft besitzt“ (κυριωτάτην ἔχει πίστιν τὸ ᾖθος). Das ist seit Aristoteles die richtungsweisende und unbestrittene Voraussetzung der Rhetorik.
Der Ethos des Redners (ᾖθος) zeigt, dass er es versteht sein Leben erfolgreich zu führen. Gelingende Lebensführung besteht in einer harmonischen Verbindung/Verschmelzung von logos (λόγος) und pathos (πάθος). Den natürlichen Neigungen und affektiven Antrieben wird eine vernünftige Form gegeben und der Vernunft eine praktische, motivierende und handlungsleitende Kraft. Der Mensch ist animal rationale. Es kommt beim Überzeugen wie bei der Lebensführung darauf an, mit seiner Natur, der physischen und der kulturellen, gelingend umzugehen. Das wirkt überzeugend. Was Menschen überzeugt ist richtig.
Antike Lachtheorien
Was wir aus Ciceros De oratore und seiner „Theorie“ des Lachens lernen können, ist viel mehr als Mary Beards „Erfindung des Witzes“ und die Erkenntnis, wie tief das Lachen insbesondere in seiner durch den scurra verkörperten Form ins gesellschaftliche Leben Roms eingelassen war. Der scurra dient als Gegenbild zu einem kultiviertem Lachen, das mit der Herausbildung der Person im „hellenistischen Rom“ verbunden ist. Das ist die epochale Erkenntnis, die wir aus dem „römischen Lachen“ gewinnen können. Sie ist z.B. aufs Engste mit der Frage der stoischen Philosophie verbunden, wie wir mit unserer (schicksalhaften) Natur und den sich herausbildenden sozialen Rollen (im Plural!) frei umgehen können.
Mary Beard glaubt nicht an große Theorien. Alle drei Theorien, die es gibt, um das Lachen zu verstehen, sind aus ihrer Sicht unzureichend. Aber vermutlich geht sie mit einem untauglichen Maßstab an die Bewertung der Theorien. Als berühmte Professorin aus Cambridge hätte sie sich an einem anderen, wahrlich nicht weniger berühmten Kopf aus Cambridge, Ludwig Wittgenstein nämlich, halten können. Wittgensteins epochaler Gedanke, menschliche Selbstverständigung in Sprachspielen zu situieren, führte zwangsläufig zu der kritischen Frage, was Spiele denn ausmacht. Ohne einen klaren Begriff vom Spiel (clare et distincte) wäre auch die „Idee“ des Sprachspiels desavouiert. Spiele aber werden nicht über die Definition eines allgemeinen Genus und spezifizierender Art ausgezeichnet, sondern über ihre „Familienähnlichkeit“ verstanden. Nicht alle Spiele gleichen sich in genau einer Hinsicht. Spiele gleichen sich vielmehr so, wie sich Familienmitglieder gleichen: die einen haben die Nase des anderen, die anderen die Augenfarbe oder die Art sich zu bewegen. Alle gehören erkennbar zur selben Familie und unterscheiden sich doch in vielerlei Hinsicht. Was für Spiele gilt, mag auch fürs Lachen gelten.
Was Ludwig Wittgenstein die Familienähnlichkeit, das war seinen metaphysischen Vorgängern die Analogie und beides hätte ernsthaft fürs Lachen genutzt werden können: was dem einen Überlegenheit ist dem andern spielerische Entlastung. Freilich ist in allen Fällen von etwas die Rede, das das „Lachen im antiken Rom“ hätte aufschließen können.
„Ich bin skeptischer als die meisten Kommentatoren, weil solche Metatheorien häufig eine zu große Vereinfachung mit sich bringen… aber ich bin doch verblüfft darüber, dass jeder dieser drei Typen – mehr oder weniger deutlich – mit einem antiken Theorieansatz verwandt ist, weshalb ich sie als „jüngere Geschwister“ bezeichnet habe. Unsere Diskussionen über das Lachen verlaufen immer noch sehr ähnlich wie die der alten Griechen und Römer.“ (55)
In den antiken Theorien übers Lachen findet sich fast alles, was übers Lachen gesagt werden kann. Die (drei) modernen Theorien zum Lachen sind „jüngere Geschwister“ der antiken Vorgänger. Das freilich sagt auch, dass wir theoretisch nichts Neues vom „alten Rom“ lernen können?!
Das sehe ich anders. Mit der „theoretischen“ Beschäftigung mit dem scurra und der Abgrenzung des vir bonus, der sich als vernünftige Kultivierung seiner Natur versteht, bildet sich etwas heraus, was unser Selbstverständnis seither maßgeblich prägt. Wir können uns zu unserer natürlichen Ausstattung und unseren kulturellen Rollen in freier Selbstbestimmung verhalten.
Keine falsche theoretische Bescheidenheit
Mary Beard theoretische Bescheidenheit ist zugleich eine Unterforderung ihrer Geschichtsschreibung. Geschichte will wissen, „wie es eigentlich gewesen“, um sagen zu können, was wir sind und uns ausmacht.
Mary Beard hat in ihren Arbeiten zur Antike immer versucht, ein echtes, ungeschöntes Bild zu zeichnen (Sklaven, Misogynie, unvorstellbar Brutalität): die viel gepriesene Kunst der großen antiken Feldherren von Alexander bis zu Caesar besteht für sie in nichts anderem als den Gegner zu hintergehen, um ihn aus dem Hinterhalt niederzumetzeln. Diese tollen, mitreißenden Einsichten sind ihr vermutlich gelungen, weil sie sich von „theoretischen“ Vorurteilen distanzierte, und die unverstellten Quellen zur Sprache gebracht hat.
Wer freilich alles so vielfältig lassen möchte, wie es vorfindlich ist, darf es nicht neu ordnen, kaum berühren und sich nicht (vorschnell) berühren lassen. Die Welt wird nicht verstanden, sondern vervielfältigt, weil das Verstehen schon ein Eingriff, eine zeitgenössische Korruption wäre. Die Römer lachen anders als wir. Ihr Lachen zu verstehen, heißt, es zu nehmen wie es ist und damit im Unverständnis zu lassen. Damit wäre wenig gewonnen.
Man braucht eine Frage, um eine Antwort zu bekommen. Was ist die Frage, die Mary Beard stellt und die ihr die Theorien ungenügend sein lässt?
Mary Beard untersucht das alte Rom, nicht das Lachen. Ansonsten hätte sie danach fragen müssen, was ist der Mensch in seiner geschichtlichen (!) Existenz, dass ihm das Lachen so ausprägen lässt, wie wir es geschichtlich z.B. „im alten Rom“ vorfinden. Was ist „das Proprium Roms“ und wie verhält es sich zu „seinem Wesen“. Lachen macht etwas mit uns und ist z.B. in den Händen des Redners eine Macht. Warum ist das so? Und wie prägt sich das in der geschichtlichen Konstellation des antiken Roms aus? Mit der Erschließung des scurra ist keine Antwort gegeben, sondern die Frage nur präzisiert.
Die Alten sind die Besten – sagt Mary Beard am Ende ihres Buchs augenzwinkernd mit Blick auf die Witze. Das können freilich nur die Jungen sagen. Dazu müssen sie die Alten kennen, sich auf sie verstehen und sie sich aneignen. Sie müssen ihre Fragen an sie stellen. Antworten können sie nur geben, wenn es Fragen gibt. Die ich mir gewünscht hätte, hat Mary Beards leider nicht gestellt. Und das ist schade, weil sie so viel mehr weiß als ich und uns das „wirkliche Rom“ in so wunderbarer Weise nahebringen kann.
Postscriptum
Mary Beard verrät übrigens auch ihren „Lieblingswitz“ von Cicero. Der findet sich auf Seite 145 und sei hier nicht verraten. Der ist nicht schlecht. Ich finde den fast besser:
„Kaiser Augustus bereist die Provinz und trifft dort auf einen jungen Mann, der ihm ziemlich ähnlich zieht. „Hat sich Deine Mutter damals öfter in Rom aufgehalten?“ fragt er den Doppelgänger. „Nee, aber mein Vater!“
Die Links dieser Seite wurden zuletzt am 20.12.2019 überprüft.
© 2019 Heinrich Leitner | Bildnachweise