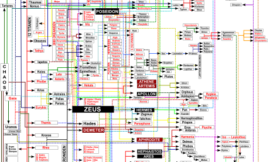„Brauchen wir moralische Regeln?“ – die Tragweite dieser Frage führt den philosophisch Nachdenkenden unweigerlich an den klassischen Stationen der Geschichte der praktischen Philosophie vorbei: von der aristotelischen Tugendethik über die Deontologie Kants bis hin zu konsequentialistischen Sichtweisen von Bentham und Mill.
Neben diesen klassischen Theorien, die sich zumeist mit der Frage beschäftigen, an welchen Prinzipien der Mensch seine Handlungen orientieren sollte, haben sich insbesondere in den letzten beiden Jahrhunderten unter dem Begriff der Postmoderne Positionen entwickelt, welche die rationalen Begründungsansätze dieser Theorien analysieren und in Teilen kritisieren.
Pragmatismus
Eine Position, die sich vor allem im angelsächsischen Raum verbreitet hat, ist der Pragmatismus. Klassische Vertreter sind beispielsweise Charles Sanders Peirce (1839 – 1914), William James (1842 – 1910) und John Dewey (1859 – 1952), auf welche ich im Verlauf dieser Arbeit noch zu sprechen komme.
Während sich das umgangssprachliche Adjektiv „pragmatisch“ tatsächlich auf die Handlung selbst bezieht (frei übersetzt in etwa „situationsabhängig“ oder „mit gesundem Menschenverstand“), setzt der philosophische Pragmatismus bei einer Kritik der traditionellen Erkenntnistheorie an.
Der Angriffspunkt dieser Kritik ist, dass insbesondere die Deontologie die Prinzipien des „richtigen“ Handelns (genauer gesagt die Pflichten) auf einer Kenntnis der Realität aufbaut. Die verschiedenen pragmatischen Positionen zweifeln hingegen entweder gänzlich die Existenz einer objektiven Realität an, sprechen der menschlichen Vernunft die Fähigkeit ab, die Realität hinreichend beschreiben zu können, oder sprechen der Suche nach einer universell gültigen Realitätsbeschreibung den Nutzen für moralische Fragestellungen ab. Für Pragmatisten ergeben sich die handlungsleitenden Prinzipien grundsätzlich aus der Wirkung der Handlung selbst. Peirce formulierte dies im Dictionary of Philosophy einmal zugespitzt: “Überlege, welche Wirkungen, die denkbarerweise praktische Bedeutung haben können, wir dem Gegenstand unseres Begriffes zuschreiben. Dann ist unser Begriff dieser Wirkungen der ganze Umfang unseres Begriffs des Gegenstandes“.[1] Somit kann der Pragmatismus im weit gefassten Sinn den konsequentialistischen Ethiktheorien zugeordnet werden, oder anders ausgedrückt: „Die Utilitaristen hatten recht, als sie das Moralische und das Nützliche miteinander verquickten“[2].
 In seiner 1994 in Wien vorgetragenen Vorlesungsreihe „Hoffnung statt Erkenntnis“ beschreibt der Neopragmatist[3] Richard Rorty die Grundpositionen der pragmatischen Philosophie. Hierfür folgt er in den ersten beiden Vorlesungen „Wahrheit ohne Realitätsentsprechung“ und „Eine Welt ohne Substanz der Wesen“ der These der zuvor angesprochenen Erkenntniskritik und stellt in der dritten Vorlesung „Ethik ohne Pflichten“ die Implikationen für die Ethik heraus. Die Vorlesungsreihe mündet in der Konklusion, der Anspruch auf universell geltende Pflichten sei nicht haltbar – eine Ethik, welche auf der Hoffnung auf eine stetige Verbesserung zwischenmenschlicher Relationen beruht, jedoch sehr wohl.
In seiner 1994 in Wien vorgetragenen Vorlesungsreihe „Hoffnung statt Erkenntnis“ beschreibt der Neopragmatist[3] Richard Rorty die Grundpositionen der pragmatischen Philosophie. Hierfür folgt er in den ersten beiden Vorlesungen „Wahrheit ohne Realitätsentsprechung“ und „Eine Welt ohne Substanz der Wesen“ der These der zuvor angesprochenen Erkenntniskritik und stellt in der dritten Vorlesung „Ethik ohne Pflichten“ die Implikationen für die Ethik heraus. Die Vorlesungsreihe mündet in der Konklusion, der Anspruch auf universell geltende Pflichten sei nicht haltbar – eine Ethik, welche auf der Hoffnung auf eine stetige Verbesserung zwischenmenschlicher Relationen beruht, jedoch sehr wohl.
Eine amerikanische Philosophie?

Rorty eröffnet seine Vorlesung mit einer kurzen historischen Einordnung der Entstehungsgeschichte des Pragmatismus. Dabei bezieht er sich im Verlauf seiner Vorlesung insbesondere auf die klassischen Pragmatisten (Peirce, James und Dewey), aber auch vereinzelt auf Neopragmatisten wie Quine, Goodman, Putnam und Davidson. Die historische Einordung nutzt Rorty außerdem, um der Annahme zu widersprechen, philosophische Denkrichtungen seien direkt mit politischen Ideologien verknüpft. Zwar sei der Pragmatismus vor allem durch amerikanische Denker geprägt und er wird auch von Dewey eine „Philosophie der Demokratie“ genannt, jedoch bestehe hier kein kausaler Zusammenhang zwischen philosophischer Haltung und politischer Ideologie: Rorty meint beispielsweise, es bestehe „kein Grund, weshalb ein Faschist kein Pragmatist sein können soll, wenn damit gemeint ist, dass er praktisch allem zustimme, was Dewey über das Wesen der Wahrheit, der Erkenntnis, der Vernunft und der Moral gesagt hat“.[4]
Den einzigen Zusammenhang zwischen einer demokratischen Haltung und dem Pragmatismus gesteht Rorty dem Umstand zu – und hier baut er geschickt die Hauptthese seiner Vorlesungsreihe auf –, dass die Politik die zukunftsorientierte Haltung des Pragmatismus übernimmt, welcher die Erkenntnis durch Hoffnung ersetzt. Den Schritt dieses Ersetzens baut Rorty weiter aus, um daraus die Argumente der nachfolgenden Vorlesungen zu entwickeln: Begriffliche Gegensatzpaare der traditionellen europäischen philosophischen Schulen (Realität und Erscheinung, das Unbedingte und das Bedingte, das Absolute und das Relative sowie das Moralische und das Besonnene[5]) sollen durch ein einziges chronologisches Gegensatzpaar substituiert werden: Vergangenheit und Zukunft.
Als Beispiel überträgt Rorty diesen Gedankengang auf die darwinistische Evolutionstheorie: „Die einzige Rechtfertigung, die es für eine biologische oder kulturelle Mutation gibt, ist der Beitrag, den sie zur Existenz einer irgendwann in der Zukunft entstehenden komplexeren und interessanteren Spezies leistet“.[6] Im Verlauf dieses Arguments wird die durch und durch antiessentialistische Haltung Rortys deutlich: So spricht er beispielsweise dem in diesem Zusammenhang von Dewey verwendeten Begriff der „Metaphysik der Beziehung zwischen Mensch und Natur“ zur Beschreibung der darwinistischen Theorie seine Gültigkeit ab, da er aus Rortys Sicht „nichts anderes ist als Demokratie“.[7]
So sehr sich die Pragmatisten bemühen, das traditionelle erkenntnistheoretische Fundament anzuzweifeln und daraus folgend „ohne Realitätsentsprechung“ auszukommen, gesteht Rorty gleichermaßen ein, dass auch der Pragmatismus ebenso wenig über Zweifeln erhaben ist: Wie andere Denkschulen, die eine konsequentialistische Haltung nahelegen, muss sich auch der Pragmatismus Fragen nach den Kriterien der Bewertung einer erhofften, möglicherweise besseren zukünftigen Situation gefallen lassen. Pragmatiker wie Dewey weichen dieser Frage entweder aus oder setzen eher schwammige Begriffe wie „Freiheit“ oder „Wachstum“ als aus ihrer Sicht ausreichende Antwort ein. Für Rorty stellen diese verschwommenen Antworten jedoch kein Problem dar. Im Gegenteil: Diese Verschwommenheit in der Begründung wird bewusst in Kauf genommen, da die Gestaltung der Zukunft keinem Plan folgt. Folglich kann auch keine klare Definition einer „guten“ oder „schlechten“ Zukunft gegeben werden. Man könnte behaupten, diese Definition entstehe erst mit dem Fortschritt der Zeit selbst.
Um die eingangs gestellte Frage, warum der Pragmatismus keine politische Ideologie kausal notwendig macht (oder umgekehrt), sehr wohl jedoch Parallelen zwischen dem Pragmatismus und der Demokratie erkennbar sind, mit einer weiteren Begründung zu bestärken, zeigt Rorty, dass klassische Philosophien, insbesondere in der griechischen Antike und folgend in Europa, in ihrem Bestreben die Realität möglichst universell zu beschreiben, die Stabilität der damals üblichen Mehrklassengesellschaft zu sichern vermochten, anstatt Veränderungen hin zum einem egalitäreren System zu begünstigen[8].
Die Absolutheit des Wahrheitsbegriffs
Angelehnt an den Theaitetos-Dialog von Platon bzw. an die Justified-True-Belief-Theorie in der Epistemologie beschreibt William James den Begriff der Wahrheit ganz in pragmatischer Tradition als „der Name dessen, was sich in puncto Überzeugung als gut – und überdies als aus bestimmten, angebbaren Gründen gut – erwiesen hat“.[9] Diese Position ist jedoch angreifbar, da sie zum einen nicht klarstellt, wodurch sich die wahre Überzeugung von einer herkömmlichen Überzeugung unterscheidet. Zum anderen lässt sie offen, wie die Bewertung von „gut“ zustande kommt (siehe oben). Durch diese beiden Versäumnisse erscheint die Definition maximal relativ.
Nach Rorty gibt es zwei Möglichkeiten, mit diesem Unvermögen den Wahrheitsbegriff zu definieren, umzugehen: Entweder, wir legen dem Begriff der Wahrheit eine epistemologische, wenn auch unerreichbare Letztbegründung zugrunde, oder wir verzichten auf eine tiefergehende Rechtfertigung der Wahrheit und lenken die Aufmerksamkeit der philosophischen Tätigkeit auf den Bereich der praktischen Anwendung.
Rorty selbst bevorzugt den zweiten Vorschlag, wobei er auch deutlich macht, dass wahre Überzeugungen durchaus existieren. In Anlehnung an Davidson ergibt sich die Wahrheit dieser Überzeugungen aus den Relationen, die wir mit unserer Umwelt eingehen. Diese Wahrheit, so Rorty und Davidson, ist auch nicht weniger wahr als irgendeine nicht-relationale universelle Absolutheit: „Die Behauptung, der Pragmatismus sei außerstande, die Absolutheit der Wahrheit zu erklären, verwechselt zweierlei Forderungen. Sie verwechselt die Forderung nach einer Erklärung der Beziehung zwischen unseren Ansprüchen auf wahre Überzeugungen und der Welt mit der spezifisch erkenntnistheoretischen Forderung nach gegenwärtiger Gewissheit oder einem Weg, der – sei es auch nur in unendlicher Zukunft – mit Sicherheit zur Gewissheit führt.“ [10]
Dadurch stellt er die Suche nach eben jener Absolutheit infrage. Die wissenschaftliche Methode folge nicht dem Ziel der Wahrheitsfindung. Vielmehr sind „Forschung und Rechtfertigung […] Tätigkeiten, denen wir uns als Sprecher einer Sprache gar nicht entziehen können. Ein Ziel namens ‚Wahrheit‘ brauchen wir dazu ebenso wenig, wie unsere Verdauungsorgane ein Ziel namens ‚Gesundheit‘ brauchen […]“.[11]
Der Antiessentialismus im Neopragmatismus
Nachdem Rorty in seiner ersten Vorlesung die klassische Erkenntnistheorie im Sinne einer pragmatischen Haltung dekonstruiert hat, widmet er sich in seiner zweiten Vorlesung „Eine Welt ohne Substanz und Wesen“ der Frage, wie im pragmatischen Denkgebäude der Bezug auf eine rein relationale Form der Wahrheit und Erkenntnis zustande kommt. Hierbei verweist Rorty zu Beginn auf die neopragmatischen Vordenker. Er beschreibt in Kürze die historischen Positionen in Bezug auf die Grenzen der Sprache im Hinblick auf die Beschreibung der Realität und fasst die neopragmatische (amerikanische) Position in Wilfrid Sellars Aussage, unser Realitätsverständnis sei maßgeblich von unserer sprachlichen Beschreibung abhängig, zusammen: „Jegliches Bewusstsein von Sorten, Ähnlichkeiten, Tatsachen, also abstrakter Entitäten, ist eine sprachliche Angelegenheit“.[12] Er grenzt damit die neopragmatische Sichtweise von traditionellen Positionen ab, die der Sprache eine beschränkende Eigenschaft auf die Realitätserfassung zuschreiben. Im Neopragmatismus ist die sprachliche Beschreibung vielmehr Realitätsbegriff genug und keine Grenze der möglichen Erkenntnis[13].
Durch diesen Kniff gelingt es Rorty, auch die Grenze zwischen einem weiteren Gegensatzpaar aufzulösen, welches er bereits in der ersten Vorlesung angedeutet hat – nämlich den Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt, also des Beschreibenden und des Beschriebenen. Wenn die sprachliche Beschreibung der Realität, also der von Sellars benannten Sorten, Ähnlichkeiten, Tatsachen und Entitäten deckungsgleich mit der unserem Realitätsbegriff selbst ist, wird die Suche nach objektiven Dingen und Eigenschaften sinnlos. Durch diese Argumentationsführung wird auch klar, warum der auf (hier: sprachlichen) Relationen aufgebaute Pragmatismus eine antiessentialistische Haltung darstellt: „Sobald die Unterscheidung zwischen dem Intrinsischen und dem Extrinsischen verschwindet, ist die Unterscheidung zwischen Realität und Erscheinung ebenfalls beseitigt und damit verlieren sich auch die Sorgen, ob es Schranken gibt zwischen uns und der Welt. Der Ausdruck ‚objektiv‘ wird von Vertretern des Antiessentialismus nicht im Sinne eines Verhältnisses zu intrinsischen Merkmalen der Gegenstände definiert, sondern mit Bezug auf die relative Mühelosigkeit beim Erzielen eines Konsenses aufseiten der Interessierten.“ [14]
Daran anschließend setzt sich Rorty mit der Kritik am antiessentialistischen Pragmatismus auseinander, der reine Fokus auf die Relationen sei zwar für manche Entitäten, beispielsweise für Zahlen, begründbar, jedoch bei materiell wahrnehmbaren Entitäten unerlaubt. Die Kritik, so Rorty, setze meist dabei an, die Relationen müssten einen Ausgangspunkt haben, also Entitäten, auf die sich die Relationen beziehen. Wie kann man über Relationen zwischen etwas sprechen, wenn wir diesem etwas keine intrinsischen Eigenschaften zugestehen? Rorty bemüht sich, dieses Argument zu entkräften, indem er jeder intrinsischen Eigenschaft der Entitäten grundsätzlich abverlangt, dass sie auch beschrieben werden könne[15] – und damit wieder zur sprachlich beschreibbaren Relation zurückführt: „Da Sätze nichts weiter leisten können, als Gegenstände in Beziehung zueinander zu setzen, wird jeder Satz, der einen Gegenstand beschreibt, implizit oder explizit eine relationale Eigenschaft von ihm aussagen“.[16] Dies würde nicht die Möglichkeit ausschließen, dass Entitäten intrinsische Eigenschaften haben können. Jedoch: Wenn sich diese Eigenschaften unserer Erkenntnis und Beschreibbarkeit entziehen, ist es wenig sinnvoll, uns über ihre Existenz Gedanken zu machen. Sobald sie in den Bereich des Erkennbaren und Beschreibbaren rücken, ist jedes Attribut ihrer Beschreibung als Relation zu uns zu verstehen.
Die Existenz möglicher intrinsische Eigenschaften von Entitäten, welche nicht durch Relationen bestimmt werden (beispielsweise Postulate in physikalischen Theorien im frühen Stadium), verlangen eine gewisse Transzendenz – eine außerhalb der möglichen Wahrnehmbarkeit stehende, göttliche Form des Menschen – um bewiesen zu werden.
Durch diese Argumentationsführung zieht Rorty den Essentialisten die erkenntnistheoretische Grundlage der traditionellen Philosophie unter den Füßen weg: Angefangen bei der platonischen Ideenlehre bis hin zur Grundlage des Begriffs der Vernunft: „[…] sei es im Sinne eines Vermögens, mit Hilfe dessen man durch die Erscheinungen bis zur Wirklichkeit vordringen kann, oder im Sinne einer Menge elementarer Wahrheiten, die in den Tiefen eines jeden von uns liegen und darauf warten, durch argumentative Erwägungen ans Licht gefördert zu werden. […] Wir Antiessentialisten glauben natürlich nicht, dass es ein solches Vermögen gibt. Da es nichts gibt, was ein inneres Wesen besitzt, haben auch die Menschen keines.“ [17][18]
Ebendiesen radikalen Antiessentialismus – der dem Menschen Vernunft und Wesen abspricht – sieht Rorty überdies als Bestätigung der in der ersten Vorlesung angesprochenen darwinistischen These.
Die Kritik an der Pflicht
In seiner dritten Vorlesung geht Rorty auf die Auswirkungen einer pragmatischen, antiessentialistischen Haltung auf die Ethik ein. Wie auch in seinen vorigen Vorlesungen stellt er dafür Gegensatzpaare auf. In Bezug auf die Ethik wählt er zunächst die Begriffe „Moralität“ und „Besonnenheit“ [19] (im Folgenden: „Abwägung“), bzw. „das Unbedingte“ und „das Bedingte“.

Durch die Darstellung der Wirklichkeit ohne intrinsische Eigenschaften der Entitäten, sondern nur als relationales Geflecht unserer Beschreibungen kann es auch keine unbedingte Grundlage für moralische Pflichten geben. Dewey empfiehlt daher, die Unbedingtheit der moralischen Pflichten durch eine „zweckdienliche Abwägung“ zu ersetzen: Nach ihm handelt der Mensch in den meisten Fällen zunächst nach Gewohnheit, also in der Art und Weise, wie es sich in bisherigen ähnlichen Situationen als zweckdienlich erwiesen hat. „Moral und Gesetz dagegen kommen zum Einsatz, sobald sich Meinungsverschiedenheiten einstellen. Wir erfinden Moral und Gesetz, sobald es nicht mehr angeht, einfach das Selbstverständliche zu tun […]“.[20] Da Moral und Gesetz nun nichts als aus der Not erfundene Konstrukte sind, setzen die Pragmatisten den Begriff der Abwägung an deren Stelle. Bei Dewey wird die in der Einleitung bereits erwähnte konsequentialistische Prägung des Pragmatismus deutlich: „‘Richtig‘ ist nur ein abstrakter Name für die Vielfalt der konkreten Handlungsforderungen, die von anderen an uns gestellt werden und die wir, sofern wir lang genug leben, mit in Betracht zu ziehen verpflichtet sind“.[21]

Im Folgenden widmet sich Rorty der kantianischen Kritik an konsequentialistischen Standpunkten, die Form der pragmatischen Abwägung könne wie Eigennutz erscheinen und die Begabung der menschlichen Vernunft und der „intrinsischen Autorität des Moralgesetztes“[22] untergraben. Rorty entgegnet hierzu wieder mit Dewey: „Diese Kritik beruht auf einer verfehlten Unterscheidung. Sie behauptet im Grunde, entweder gingen die idealen Maßstäbe den Gebräuchen voraus und verliehen diesen ihr moralisches Gepräge oder sie seien bloß zufällige Nebenprodukte, da sie nach den Bräuchen kämen und sich aus diesen entwickelten. Doch wie steht es etwa mit der Sprache? […] Die Sprache ist aus geistlosem Lallen hervorgegangen, aus instinktiven Bewegungen, die man Gebärden nennt, und aus Druck der Umstände. Aber dennoch ist die Sprache, sobald sie erst einmal existiert, Sprache und wirkt als Sprache.“[23]
Mit dieser Analogie setzt Dewey die bereits zuvor begonnene darwinistische Argumentationsstruktur fort. Um die Kritik der kantianischen Sichtweise auf den Pragmatismus zu erwidern, entgegnet Dewey, die kantianische Haltung verrenne sich im Versuch eine Verallgemeinerung zu entwickeln, welche nicht über das Stadium von gut gemeinten Empfehlungen im kategorischen Imperativ hinausgehen. Dewey greift bei der Gegenkritik stellenweise auf ein Vokabular zurück, welches weniger sachlich, sondern vielmehr als ein „argumentum ad hominem“ gegenüber Kant aufgefasst werden kann. So spricht er der kantianischen Idee in ihrem Ursprung eine „völlige Allgemeingültigkeit“ sowie „ein autoritäres Prestigedenken“ zu.[24]
Das empfindsame Ich
Nach dieser Gegenkritik an der Unbedingtheit von kategorischen Pflichten führt Rorty das Muster der Begriffssubstitution fort. Um die Moralität durch Abwägung zu ersetzen, untersucht er eine weitere Gegenüberstellung: Moralität und Empfinden. Dabei bezieht er sich hauptsächlich auf Annette Baier, welche in Anlehnung an David Hume die Empfindsamkeit als zentrales Element ethischer Fragestellungen positioniert.
Das bereits erwähnte Argument, Moral und Gesetz seien nur eine notgedrungene Erfindung, ließe sich ebenfalls mit dem Gefühl begründen, welches wir bei Handlungen mit Unsicherheit empfinden, meint Rorty: „Die spezielle Pflicht, die wir spüren, wenn wir den Ausdruck ‚moralisch‘ verwenden, ist nichts weiter als das von uns empfundene besondere Bedürfnis, in relativ unvertrauter und noch nicht ausprobierter Weise zu handeln, […] Unser Gefühl, [Abwägung] sei unheroisch, Moralität dagegen heroisch, ist lediglich die Einsicht, dass die Erprobung des relativ Unerprobten gefährlicher und riskanter ist, als die Ausführung natürlicher Handlungen.“ [25]
Ebenso wie Rorty und Dewey sieht auch Baier die klassischen vernunftfokussierten Ethiken als zu beschränkt an: „Der Bösewicht ist die rationalistische auf Gesetze fixierte Tradition der Moralphilosophie […, der es] misslingt die moralische Pflicht zu erklären“.[26] Dem bereits angeführten Standpunkt folgend, die Wirklichkeit sei einzig durch Relationen beschreibbar, stellt sich dem Leser die naheliegende Frage, gegenüber wem oder was die genannte moralische Pflicht überhaupt gelten solle.
„Baier ist [dabei] ebenso wie Dewey der Meinung, dass der Hauptfehler eines großen Teils der Moralphilosophie in dem Mythos liegt, das Ich sei etwas Nichtrelationales und dazu imstande, frei von jeglicher Sorge um andere als kalter Psychopath zu existieren […] Doch wenn wir dem Rat der Pragmatisten folgen, alles als durch seine Beziehungen zu allem Übrigen konstituiert zu sehen, wird es leichtfallen, dem Trugschluss auf die Spur zu kommen, bei dem man, um mit Dewey zu sprechen, ‚die Binsenweisheit, dass man als Ich handelt, in die Fiktion verwandelt, für immer für das Ich zu handeln‘“.[27]
Im nächsten Schritt stärkt Rorty die pragmatische Position, die Pflicht durch Empfindsamkeit zu ersetzen, durch ein Gedankenexperiment: Zunächst stellt er dem Leser die Frage, wie wir uns im Alltag verhalten. Wägen wir unsere Handlungen tatsächlich nach einer besonderen Pflicht ab, oder handeln wir nicht viel eher aus einem natürlichen Mitgefühl, also aus einem Empfinden heraus? In einem Beispiel ausgedrückt: „Wir möchten nicht gut genährt sein, solange unsere Kinder hungern; das wäre unnatürlich. Wäre es auch unmoralisch? Es wäre ein wenig seltsam, es so zu formulieren […]“.[28] Doch nehmen wir für den Moment an, wir würden aus uns selbst heraus einzig aus Pflicht handeln. Und nehmen wir weiter an, diese Pflicht würde kategorisch gelten, also vollkommen unbedingt und für jeden gleich. Welcher Bedarf bestünde dann noch, diese Pflichten zu definieren? Wieder verdeutlicht er an einem Beispiel: „Doch das Christentum hat das Abendland gelehrt, zuversichtlich einer Welt entgegenzusehen, […] in der alle Männer und Frauen Brüder und Schwestern sind. In dieser Welt gäbe es keinen Anlass, von ‚Pflicht‘ zu reden“ (Rorty 2013, S. 77). Halten wir in unserem Experiment nun weiter daran fest, unserem Handeln würde jede kategorische Pflicht zugrunde liegen. Wie erklären wir uns dann, so fragt Rorty, dass wir auch hinsichtlich unseres Mitgefühls nach Präferenzabstufungen handeln, also gegenüber unseren eigenen Kindern ein stärkeres Mitgefühl entwickeln als anderen Menschen[29]?
Dieses Dilemma lasse sich auf zwei Wegen lösen: „Der eine Weg führt allem Anschein nach [den Präferenzabstufungen folgend] zu einer dualistischen Metaphysik der Aufspaltung des menschlichen Ichs und womöglich des ganzen Weltalls überhaupt in höhere und niedrigere Teilstücke. Der andere Weg dagegen scheint dahin zu führen, dass wir pauschal auf unsere Bestrebungen verzichten, ‚höhere‘ Stufen als die der Animalität zu erreichen.“[30]
Der zweite, pragmatische Weg legt also nahe, wir sollten das Experiment der rationalen und unbedingten Erklärung von Pflichten und Gesetzmäßigkeiten aufgeben und das menschliche Verhalten als evolutionäre Gegebenheit ansehen: „An die Stelle der Idee einer Theorie, welche die Realität an den Gelenken tranchiert, setzen die Pragmatisten die Vorstellung von einer maximal leistungsfähigen Erklärung […]. An die Stelle der Kantischen Idee des guten Willens setzen sie die Vorstellung von einem maximal gütigen, sensiblen und mitfühlenden Menschen.“ [31]
Zum Abschluss seiner Vorlesungsreihe zeigt Rorty am Beispiel der Menschenrechte, dass der Pragmatismus (wie mehrfach dargelegt) nicht die Existenz von Regeln und Pflichtbeschreibungen bestreitet, sondern allein die erkenntnistheoretische Begründung anzweifelt. „Man wird Ideen nicht nach ihrem Ursprung, sondern nach ihrer relativen Nützlichkeit einstufen“.[32]
Diesen Bezug auf eine relative Beschreibung der Welt einerseits sowie die zukünftige Nützlichkeit von Handlungen andererseits bei gleichzeitigem Ersetzen essenzieller Annahmen der traditionellen Philosophiegeschichte (Eigenschaften von Entitäten, Objektivität, Unbedingtheit, Moral, usw.) nutzt Rorty, um basierend hierauf die finale Substitution seiner Vorlesungsreihe vorzunehmen: Durch den begründeten Zweifel an den zugrundeliegenden Begriffen der klassischen Erkenntnis ersetzt Rorty die Erkenntnis selbst durch den Begriff der Hoffnung auf eine bessere Welt als philosophisches Fundament des Pragmatismus.
Zum Schluß
Die Lektüre der Vorlesungsreihe „Hoffnung statt Erkenntnis“ stellt deutlich die antiessentialistische amerikanische Position des Pragmatismus dar. Als Anhänger essentialistischer europäischer Philosophietraditionen fühlt man sich kontinuierlich eingeladen, Gegenargumente zu entwickeln (bspw.: Ist die Eigenschaft, vier Ecken zu haben, tatsächlich keine intrinsische Eigenschaft eines Vierecks, sondern erst real durch unsere Beschreibung?). Einige typische Gegenargumente bemühte sich Rorty bereits zuvor in seinem Opus Magnum „Der Spiegel der Natur“ zu entkräften. Die Frage, ob ihm diese Verteidigung des Pragmatismus gelingt und wie weit man gewillt ist der antiessentialistischen Position zu folgen, obliegt dabei dem Leser.
Vereinzelte Stellen der ersten Vorlesung „Wahrheit ohne Realitätsentsprechung“ zeigen aber auch Auswege auf: Insbesondere die Position von Davidson kann auch so aufgefasst werden, eine objektive Wahrheit könne durchaus existieren – jedoch mache die wissenschaftliche Auseinandersetzung hierüber keinen Sinn, solange uns hierfür die Möglichkeit einer Beschreibung fehle. Im weiteren Verlauf der Vorlesungsreihe folgt Rorty dieser Position jedoch nicht.
Eine Frage, die ich Rorty zum Abschluss allerdings gerne auf seine Position „Man wird Ideen nicht nach ihrem Ursprung, sondern nach ihrer relativen Nützlichkeit einstufen“[33] erwidern würde, wäre: Was wäre, wenn sich herausstellen würde, dass die Bemühung um Erkenntnis einer absoluten Wahrheit eine relative Nützlichkeit aufweisen würde?
[1] The Essential Peirce. Selected philosophical writings Vol. 1 (1867-1893), hrsg. v. Nathan Houser und Christian Kloesel, 1992, S. 132.
[2] Richard Rorty, Hoffnung statt Erkenntnis. Eine Einführung in die pragmatische Philosophie, 2013, S. 69. Im weiteren Textverlauf schränkt Rorty diese These wieder etwas ein, indem er die utilitaristische Lust-Leid-Bilanzierung als zu verkürzt darstellt. Nichtsdestotrotz ordnet er die pragmatische Ethik klar den konsequentialistischen Theorien zu.
[3] Der Neopragmatismus führt im Grunde genommen die Erkenntniskritik der zuvor genannten PragmatismusVertreter fort. Er unterscheidet sich vor allem durch die zusätzliche Skepsis nach der so genannten „Linguistischen Wende“, Sprache allein würde ausreichen, um die Wirklichkeit zu erfassen (vgl. Rorty 2013, S. 13).
[4] Rorty 2013, S. 11.
[5] In der deutschen Übersetzung Rortys wird das Wort „Besonnenheit“ verwendet. An dieser Stelle ist jedoch nicht die Tugend gemeint (Sophrosyne, vgl. bspw. Platons Politea). Rorty bezieht sich im Verlauf der Vorlesung auf Dewey, welcher in seinem Text das englische Wort „Deliberation“ nutzt, welches vielmehr mit „Abwägung“ übersetzt werden kann. (Vgl. John Dewey, The collected works of John Dewey. Human nature and conduct, hrsg. v. Jo Ann Boydston und Murray G. Murphey, 2008, S. 223.
[6] Rorty 2013, S. 15–16.
[7] Rorty 2013, S. 16.
[8] Rorty zeigt an dieser Stelle auch einen Vergleich mit dem Marxismus auf, der die Veränderung der Klassenverhältnisse noch stärker als der Demokratie-Vergleich in den Mittelpunkt stellt (vgl. Rorty 2013, S. 19).
[9] William James, Pragmatism, hrsg. v. Fredson Bowers und Ignas K. Skrupskelis, 1976, S. 43.
[10] Rorty 2013, S. 23.
[11] Rorty 2013, S. 29.
[12] Wilfrid Sellars, Der Empirismus und die Philosophie des Geistes, 2017, S. 203f.:
[13] In einem späteren Absatz stellt Rorty klar, dass mit dem Begriff „Sprache“ nicht nur eine Benennung oder Zeichenfolge gemeint sei, sondern vielmehr eine wahrnehmbare „wechselseitige Einflussnahme“ (vgl. Rorty 2013, S. 59).
[14] Rorty 2013, S. 41–42.
[15] Im Essay „What Mary didn’t know” beschreibt Frank Jackson ein Gedankenexperiment, bei dem die Person Mary beim erstmaligen Erblicken einer Farbe (reale) Sinneseindrücke erfährt, welche sich durch Sätze nicht beschreiben ließen. Ein solches Argument könnte man hier gegen die rein auf sprachlichen Relationen aufgebaute Realität anbringen (Frank Jackson, What Mary Didn’t Know, In: Journal of Philosophy 83 (5), 1986, online verfügbar unter https://philpapers.org/rec/JACWMD).
[16] Rorty 2013, S. 48.
[17] Über das menschliche Unvermögen der Vernunft hinaus setzt sich Rorty in seinem Werk „Der Spiegel der Natur“ generell kritisch bzgl. der Existenz rein menschlicher geistiger bzw. mentaler Zustände auseinander (Richard Rorty Der Spiegel der Natur: eine Kritik der Philosophie. Eine Kritik der Philosophie, 2017, S. 27–76).
[18] Rorty 2013, S. 58
[19] Vermutlich mehrdeutige Übersetzung, vgl. Fußnote 3. Ich verwende im folgenden Text den Begriff „Abwägung“.
[20] Rorty 2013, S. 69.
[21] Dewey 2008, a.a.O. S. 224
[22] Rorty 2013, S. 70.
[23] Dewey 2008, a.a.O. S. 56.
[24] Dewey 2008, a.a.O. S. 68.
[25] Rorty 2013, S. 73.
[26] Annette Baier, Postures of the mind. Essays on mind and morals, 1985, S. 236. Online verfügbar unter http://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttt6mv.
[27] Rorty 2013, S. 73–74.
[28] Rorty 2013, S. 75.
[29] Peter Singers greift eine sehr ähnliche Fragestellung in seinem Gedankenexperiment „The Drowning Child“ auf und verdeutlicht das Dilemma zwischen Mitgefühl und kategorischer Pflicht (vgl. Peter Singer, The Drowning Child and the Expanding Circle, in: New Internationalist, 1997. Online verfügbar unter https://newint.org/features/1997/04/05/peter-singer-drowning-child-new-internationalist
[30] Rorty 2013, S. 78.
[31] Rorty 2013, S. 81.
[32] Rorty 2013, S. 83.
[33] Rorty 2013, S. 83.