Wir wollen wissen, woher wir kommen. Um zu wissen, was uns ausmacht, blicken wir auf unsere Geschichte. Geschichte lässt sich grundsätzlich unter drei Hinsichten betrachten, nämlich als
- die Wiederkehr des Gleichen (I), als
- Fortschritts- (II) oder als
- Verfallsgeschichte (III).
Ewige Wiederkehr des Gleichen (I)
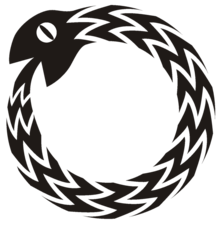
Wer aus der Geschichte etwas lernen will, der muss wohl unterstellen, dass sich die gestrigen Dinge nicht fundamental von den heutigen unterscheiden. Vielleicht begegnet uns nicht das Gleiche, aber doch sehr Ähnliches. Und weil dem so ist, können wir vielleicht aus den Fehlern lernen, die unseresgleichen vor uns gemacht haben. Geschichte besteht aus den vielen individuellen Geschichten, die uns etwas sagen ohne dass die Welt dadurch eine andere oder bessere würde. Sie erzählt das Besondere, das sich wirklich ereignet hat und gleicht damit der Literatur, die in ihren Geschichten erleben lässt, wie es hätte sein können.[1]
Geschichte als Fortschritt (II)

Anders sieht das die Fortschrittsgeschichte. Sie findet sich bei den Aufklärern, aber auch bei Eschatologen: die Sache entwickelt sich prächtig und geht für die Guten gut aus. „Geschichte wird gemacht, es geht voran!“. Diese Vorstellung ist insbesondere für die Naturwissenschaften prägend – Geschichte heißt Überwindung von Irrtümern und Unwissenheit. Die Gegenwart ist die Wahrheit, an der sich die Unzulänglichkeit der Geschichte zeigt. Wir müssen als Physiker, Biologen oder Mediziner nicht Galilei oder Newton, Darwin, von Behring oder Sir Fleming lesen. Lehrbücher auf dem aktuellen Stand sind da die bessere Quelle und versammeln das aktuelle Wissen. Es hat zwar eine Geschichte, ist selbst aber nicht geschichtlich. Die Geschichte der Naturwissenschaft ist die Geschichte der Ignoranz. Sie besteht im Wesentlichen aus den Irrtümern, die zurückbleiben. Fortschrittsgeschichte ist „Zukunftsgeschichte“. Das heutige Wissen ist eines, das korrigiert und weiterentwickelt werden muss. Das iPhone kaufen wir uns heute nur, um das neue, auf das wir sehnsüchtig warten, auf den Markt zu bringen.
Verfallsgeschichte (III)

Betrachten wir dagegen die Geschichte als Verfallsgeschichte, dann finden wir in ihr „Wahrheiten“, die verloren gingen und bewahrt werden sollten. Hier lernen wir in einem ausdrücklichen Sinn aus und von dem, was vor uns war. Tatsächlich hat diese Vorstellung die Geschichte der Menschheit über Jahrtausende geprägt. Das Alte war das Gute, das Bewährte, das die Jungen nicht verlieren, sich vielmehr aneignen sollten. Schulen und Universitäten waren Orte der Vergegenwärtigung, nicht der Forschung. Diese Sicht prägt die traditionellen Geisteswissenschaften. Wer Homer und Shakespeare liest, Platon und Kant studiert oder Werke von Praxiteles oder Michelangelo betrachtet, der sucht keine Fehler, sondern Maßstäbe fürs eigene Leben.
Zurück zu den Griechen
„Was Europa den Griechen verdankt“[2] ist eine langweilige historische Frage. Ein solcher Rückblick kann offenbar nichts bieten, das uns zum Nachdenken bringt. Es kommt einer Laudatio auf die eigene Gegenwart gleich und wie bei allen epideiktischen Reden geht es, die Zustimmung aller immer schon vorausgesetzt, nur darum, in die richtige, feierliche Stimmung zu kommen. Geschichtliches Andenken in diesem Sinne ist willfährige Selbstbestätigung für unsichere Zeitgenossen. Stattdessen sollten wir fragen, was uns die Griechen zu denken geben, was sie uns mit- und aufgeben, das heute noch unabgegolten ist.[3]
Im Anfang
Gehen wir weit zurück zu den Anfängen und gucken, was uns da Herausforderndes begegnet. „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde…“[4] Auch das mag uns einen Anstoß für Besinnung geben – zumal vieles, was darauf folgt nicht (mehr) recht in unser Weltbild zu passen scheint. Genesis 1 berichtet von einem Sechstagewerk, an dessen Ende der Mensch geschaffen und ihm die Schöpfung übergeben wird. Die sechstägige Schöpfungsgeschichte ist angesichts unseres naturwissenschaftlichen Wissens über das Bestehen des Universums (ca 13,8 Mrd. Jahre), der Erdgeschichte (gut 4 Mrd. Jahre) und der Evolution von Lebewesen und Mensch (etwa 3,5 Mrd Jahre) verstörend. Hinzukommt, dass wir in Gen 2 eine in einige Punkten abweichende Geschichte präsentiert bekommen. Das mag redaktionelle Gründe haben oder die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Die erste Version, ältere Version entstand ca. 900 v. Chr., die jüngere ca. 300 bis 400 Jahre später. Das soll uns im Moment nicht kümmern. Jedenfalls gilt. „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“, also (irgendwie) alles – mit Bedacht und Vorsatz.
Anfängliches Chaos
 Dies ist gar nicht so selbstverständlich. Das zeigt ein Blick nach Griechenland. Dort entsteht um 700 v. Chr. die Theogonie (Θεογονία), Hesiods Lehrgedicht darüber „wie am Anfang die Götter entstanden“.[5] Es beginnt mit Chaos: „Wahrlich, als erstes ist Chaos entstanden, doch wenig nur später Gaia, mit breiten Brüsten, aller Unsterblichen ewig sicherer Sitz…“[6] Auch hier geht einiges durcheinander. Aus dem Chaos entsteht die die Lichtlosigkeit der Tiefe, Erebos, und die der nichtigen, unbestimmten Höhe, Nyx, die sich dann zu Äther und Hemera vereinigen, der Offenheit des Tages.[7] Schließlich entlässt Gaia Uranos, den Himmel oder besser das Himmelhafte, damit „er [Uranos] sie völlig umhüllte und den seligen Göttern ein sicherer Sitz sei für ewig“.[8] Uranos legt sich über Gaia und aus dieser „Vereinigung“ entstehen die Titanen, z.B. der erstgenannte Okeanos: „Okeanos aber entströmte tief, voller Wirbel dem Lager, das sie [Gaia] mit Uranos teilte.“[9] Neben den Titanen erwachsen ihr die Kyklopen, „Trotz und Wildheit im Herzen“ und die Hekatoncheiren, die hundertarmige Ungeheuer: „Hundert Arme flogen um ihre gewaltigen Schultern, ungeschlachte; und fünfzig Köpfe trug auf den Schultern jeder, zu Häupten des gedrungenen Körpers. Viele waren der Ehe von Erde und Himmel entsprossen, keine aber so schreckenerregend wie diese, dem eigenen Vater von Anfang verhaßt.“[10]
Dies ist gar nicht so selbstverständlich. Das zeigt ein Blick nach Griechenland. Dort entsteht um 700 v. Chr. die Theogonie (Θεογονία), Hesiods Lehrgedicht darüber „wie am Anfang die Götter entstanden“.[5] Es beginnt mit Chaos: „Wahrlich, als erstes ist Chaos entstanden, doch wenig nur später Gaia, mit breiten Brüsten, aller Unsterblichen ewig sicherer Sitz…“[6] Auch hier geht einiges durcheinander. Aus dem Chaos entsteht die die Lichtlosigkeit der Tiefe, Erebos, und die der nichtigen, unbestimmten Höhe, Nyx, die sich dann zu Äther und Hemera vereinigen, der Offenheit des Tages.[7] Schließlich entlässt Gaia Uranos, den Himmel oder besser das Himmelhafte, damit „er [Uranos] sie völlig umhüllte und den seligen Göttern ein sicherer Sitz sei für ewig“.[8] Uranos legt sich über Gaia und aus dieser „Vereinigung“ entstehen die Titanen, z.B. der erstgenannte Okeanos: „Okeanos aber entströmte tief, voller Wirbel dem Lager, das sie [Gaia] mit Uranos teilte.“[9] Neben den Titanen erwachsen ihr die Kyklopen, „Trotz und Wildheit im Herzen“ und die Hekatoncheiren, die hundertarmige Ungeheuer: „Hundert Arme flogen um ihre gewaltigen Schultern, ungeschlachte; und fünfzig Köpfe trug auf den Schultern jeder, zu Häupten des gedrungenen Körpers. Viele waren der Ehe von Erde und Himmel entsprossen, keine aber so schreckenerregend wie diese, dem eigenen Vater von Anfang verhaßt.“[10]
Wir sehen, es zeigt sich ein ganz anderes Bild als in der biblischen Genesis. Hier ist kein Gott, der die Welt wissen- und willentlich erschafft, alles „wächst“ aus der gähnenden Leere des Chaos,[11] einem Nichts, das sich wie ein klaffender Schlund auftut und aus dessen Unbestimmtheit etwas entströmt, das schließlich Ordnung annimmt.[12] Chaos ist selbst kein Gott. Es ist der „Leerraum“ für göttliches „Wirken“, das sich auf seinen Ur-sprung bezieht und sich daraus versteht. Das Sein entwächst einem „chaotischen Grund“, einer klaffenden Leere des Unbestimmten, die „ist“ insofern sie „im“ oder „am“ Seienden ist. Gaia ist Pro-dukt des Chaos, greift in diesem Raum und bleibt in ihm immer verortet. Das Chaos gewinnt Gestalt, so wie Gaia sich in Gestalten „entäußert“: sie nimmt selbst Gestalt an, umhüllt sich mit Uranos und bringt neue Gestalten hervor. Gaia und Uranos gehören zusammen und bilden für die Götter den „sicheren Sitz“ (ἕδος ἀσφαλές), den ihnen unverbrüchlich zukommenden Ort ihres Seins.
Freigesetzte Kräfte
In diesen Veräußerungen liegt zugleich (chaotische) Spannung. Uranos hasst seine gewaltigen, hundertarmigen Nachkommen: „Und immer wenn einer geboren, den verbarg er sogleich im Schoß der Erde, und nicht mehr ließ er ans Licht ihn zurück und freute sich noch seiner Untat, Uranos. Sie aber stöhnte im Innern, die riesige Gaia, jammernd. Und listig ersann sie kunstvoll-schreckliche Rache.“[13] Gaia liegt mit „ihrem“ Uranos so in Aus-einander-setzung wie Uranos mit der gemeinsamen Nachkommenschaft: er möchte die freigesetzten Kräfte der Hekatoncheiren immer wieder in Gaia zurückbinden, sie in den Mutterleib zurückgeben, während die Mutter sie um ihrer selbst willen frei zu geben drängt.
 Das Unheil nimmt seinen Lauf. Gaia stiftet eines ihrer Titanenkinder, Kronos, zum Aufstand gegen Uranos an. Er ist der jüngste Titan, „krummgesinnt“ und das „fürchterlichstes der Kinder“ und „hasste den blühenden Vater“.[14] Kronos „entmannt“ den verhassten Vater und sperrt ihn (zu den Kyklopen und den Hekatoncheiren) in den Tartaros.[15] Uranos verflucht ihn und sagt ihm ein ähnliches Schicksal voraus.
Das Unheil nimmt seinen Lauf. Gaia stiftet eines ihrer Titanenkinder, Kronos, zum Aufstand gegen Uranos an. Er ist der jüngste Titan, „krummgesinnt“ und das „fürchterlichstes der Kinder“ und „hasste den blühenden Vater“.[14] Kronos „entmannt“ den verhassten Vater und sperrt ihn (zu den Kyklopen und den Hekatoncheiren) in den Tartaros.[15] Uranos verflucht ihn und sagt ihm ein ähnliches Schicksal voraus.
Kronos ist nun titanischer Weltenherrscher und aus der Vereinigung mit seiner Schwester Rhea entspringen neue Götter(kräfte), die er freilich alle umgehend verschlingt, um sie bei sich zu behalten. Die freigegebenen Kräfte könnten sich gegen ihn wenden und der Fluch sich erfüllen.[16] Damit bringt er Rhea gegen sich auf, die nun im Zusammenwirken mit ihrer „Mutter“ Gaia, Zeus vor dem Verschlingen rettet und zum Aufstand gegen Kronos anleitet.
Titanomachie

Zeus überlistet Kronos, seine verschlungenen Kinder wieder freizugeben. Die Titanomachie beginnt. Den Kampf gegen den Vater und die widerstreitenden Titanen können die Kroniden freilich nur gewinnen, indem sie verbannte Kräfte zurückholen. Uranos hatte die Kyklopen und Hekatoncheiren in den Tartaros verbannt. Eine „weltfremde“ Unterwelt, die ihren Einfluss auf die Welt verhindern sollte. Ihre Wirksamkeit sollte aufs Welt-Jenseitige, aufs Unter-Irdische, begrenzt werden, deren „Physik“ sich von der der Welt unterscheidet. Sie war „Meta-Physik“ als Hypokeimenon, als unerreichbares „Ding an sich“, das irgendwie als entzogenes da war. Kronos hatte nach seinem Sieg die von Uranos in den Tartaros Verbannten nicht befreit. Zeus gelingt ihre Befreiung und er führt sie in die Auseinandersetzung mit Kronos zurück. Mit ihrer Hilfe wird der Kampf gewonnen. Er verbannt Kronos schließlich auf die Insel der Seligen, dem Gegenbild zum Tartaros.
Verschlingen und Freisetzen
Kronos verschlingt alle seine Nachkommen sobald sie auf die Welt kommen und sich als etwas Bestimmtes und von ihm Unterschiedenes zeigen. Er hat sie entlassen und will sie aber als seine Kräfte behalten, nämlich als unterschiedene Teile oder Äußerungen seiner „Grund“-Kraft. Er ist ihre unbestimmte Einheit. Es sind ge- und unterschiedene Kräfte, die er zusammenhalten will, deren Selbständigkeit er verhindern will. Er wirkt mit ihnen in Ununterschiedenheit. Die Unterscheidung und ihr Wirken als unterschiedene im Zusammen- und Gegeneinander-Wirken, verschiebt das Zentrum. Sie wirken im ununterschiedenen Ganzen zusammen und behaupten sich darin gegeneinander und gegen die ununterschiedene Einheit ihrer Herkunft.[17]
Das Dasein der Götter
Kronos und Zeus können ihre Väter nicht töten, sie können sie nur in ihren „Äußerungen“ beschränken und in ihrem Wirken beeinflussen. Götter sterben nicht. Weil sie es nicht können. Ihre Natur ist zu sein und zu wirken. Sie sind und bleiben oder sie waren nie, vor allem keine Götter. Zeus verbannt Kronos in den „metaphysischen“ Raum der Insel der Seligen, die mal das Luxus-Altenheim für störende alte Götter genannt wurde, um sie vom Leben der Welt fernzuhalten.

Ein anderes prominentes Beispiel für die schmerzliche Unsterblichkeit der Götter ist Prometheus. Nach dem Raub des Feuers und seiner Zuwendung zu den Menschen wird er von Zeus verurteilt, am Felsen geschmiedet zu leiden. Das ist seine Existenz. Sein Wesen. Sein ewiges Wirken. Er leidet, weil er nicht sterben kann. Und Leiden ist sein Leben.[18]
Der „letzten“ Freiheit, sich das Leben zu nehmen, sich selbst oder einander, erfreuen sich die Götter nicht. Sie müssen ewig sein, was sie sind. Wenn sie sich verändern, dann nur für uns, nicht an sich. Sie zeigen sich uns anders – ohne doch andere geworden zu sein. Dass Götter nicht sterben bedeutet, dass ihre Geschichte keinen Abschluss findet und nicht finden kann. Ihre Geschichte ist ihr Sein. Sie lässt sie erscheinen wie sie sind.
In diesem Sinne zeigt die Titanomachie das Wesen der Götter, nein, ist selbst ihr Wesen. Es ist nicht etwas, das der Vergangenheit angehört. Sie ist eine Symphonie, die aus einzelnen Stimmen (Instrumenten) besteht oder erwächst. Die urtümliche Macht der Titanen ist in der sich begrenzenden, selbstbestimmenden Kraft der olympischen Götter präsent.
An- und Abwesenheit
Uranos drängt die freigesetzten Kräfte zurück in den Tartaros, ins dunkle Innere Gaias, so als wären sie nie „geboren“ worden. Aber sie sind da und werden durch Zeus wieder zu sichtbarer Wirkung gebracht. Er seinerseits verbannt dorthin die Titanen, die sich seiner Herrschaft widersetzen, nicht ohne den Tartaros durch die Hekatoncheiren bewachen zu lassen. Die Verbannten sind nur verbannt, ihre Wirksamkeit besteht weiterhin, sie muss durch Ent-Fernung beherrscht werden. Das gilt auch für Uranos und Gaia, die weiterhin wirken, deren Wirken nur begrenzt oder bestimmt ist. Sie bleiben der „sichere Sitz“ der Götter, ihr unverbrüchlicher Ort ihres Seins. Sie sind ihre Äußerungen, ihre Nachkommen als ihre Veräußerungen. Sie drücken sich aus, begrenzen sich erscheinend in ihnen und sind in ihnen „verborgen“ da. Göttergeschehen ist, sagt Wolfgang Schadewaldt, „das Ans-Licht-Treten eines Verborgenen“,[19] das das Geschehen bestimmt
„Weg-Sein“ ist eine Form des „Da-Seins“, der Anwesenheit. In Form der Langeweile z.B. oder in der Sehnsucht. Im Vermissen ist das Vermisste auf erschütternde Weise präsent. Das ist auch der wesentliche Sinn von „Verdrängung“. Damit etwas abwesend ist, muss es „da“ sein und zwar nicht irgendwo, sondern wirksam hier. Im Verdrängen von etwas wird das Zurückgedrängte nicht Nichts. Es bleibt wirkend im Hintergrund.
Uranos und Kronos sind da. Sie sind ent-fernt. Als die „alten“ Titanen durch „neuen“ Olympier besiegt sind, gebiert Gaia Typhon, ein schreckliches Ungeheuer, um in der neuen Welt die Gegenwart der alten sichtbar zu machen. Es ist ein Zeichen, dass Zeus Herrschaft sich ständig gegen Gaias Gewächse behaupten muss. Die olympische Ordnung liegt im ewigen Kampf mit der (Un-)Ordnung des Werdens aus Gaia, der irdischen, unbestimmten Mächte. Die Macht des Zeus lebt von diesem Hinter-Grund.[20] Sein Vor-Rang bestätigt das Nach-Rangige. Die Oberfläche lebt aus der Tiefe.
Geschichtliche Aufhebung
Was sollen wir nun mit dieser Theogonie machen, die uns doch offenbar recht fremd zu sein scheint? Wir glauben nicht mehr an („griechische“) Götter, was vermag uns dann der Mythos ihrer Entstehung und ihres Werdens sagen? Und zu wissen, was sich Leute vor uns Seltsames ausgedacht, macht doch nur Sinn, wenn uns das etwas zu sagen hat. Eine hermeneutische Grundregel besagt, von der Vollkommenheit und der Wahrheit des Textes auszugehen. Das ist keine wohlwollende Haltung, die man auch lassen und nur aus Höflichkeit für die Lektüre mitbringen sollte, sondern eine notwendige Bedingung wirklichen Verstehens überhaupt. Nur so, können wir uns vom Text (und der Tradition) etwas sagen lassen.
Wir hatten anfänglich drei Perspektiven unterschieden, aus denen wir Geschichte betrachten und erzählen können. Nehmen wir die Göttergeschichte der Theogonie ernst, dann gibt sie uns auch Einsicht in das Wesen der Geschichte selbst. Das Alte, Zurückgedrängte, bleibt im Neuen wirksam. Das Verstörende der Theogonie ist zugleich der Schlüssel für ein besseres „Selbst- und Weltverständnis“. Die Geschichte vom Werden der Götter schließt uns das Wesen unserer geschichtlichen Existenz und unserer Verständigung über sie auf.

Hegel, der die Geschichte in die Philosophie gebracht hat, spricht hier von „Aufhebung“ und sieht darin die drei Bedeutungen von „aufheben“ wesentlich verbunden: das Abschaffen ist geschichtlich eines, das die geschichtlichen Grund bewahrt und in eine neue Form erhebt. Wer sich einzig auf die neue Gestalt fokussiert (II), der vermag die Grundkräfte darin nicht zu sehen, die weiterhin wirken (III) und zu neuerlicher Aufhebung treiben (I). Gegenwart als aufgehobene Vergangenheit und wir verstehen sie besser, wenn wir die Wahrheit der Alten zur Geltung bringen und ihren unabgegoltenen Ansprüche der Alten gerecht werden.
[1] So das Verständnis der Historie (ἱστορία) in ihren Anfängen bei Herodot und Thukydides.
[2] Cf. Th. A. Szlezak, Was Europa den Griechen verdankt, Von den Grundlagen unserer Kultur in der griechischen Antike, 2010.
[3] In „Auch eine Geschichte der Philosophie“ (2019) geht Jürgen Habermas genau dieser Frage nach: Was können wir aus der Geschichte der Philosophie in dem Sinne lernen, dass in ihr etwas begegnet, was in der durch gute Gründe motivierte Weiterentwicklung unberücksichtigt blieb und uns bei der „rationalen Klärung unseres Selbst- und Weltverständnisses“ zu denken gibt (a.a.O., S. 12). Ich werde diesem beeindruckenden Alterswerk von Habermas in den nächsten Monaten einige, vermutlich sehr ehrfürchtige Beiträge widmen.
[4] Gen 1, 1
[5] Theogonie 108.
[6] Theogonie 116f.
[7] Vieles kommt darauf an, das omen des nomen beim Götternamen richtig zu verstehen. Hemera ist die Göttin des Tages, des Taghaften. Sie ist das, was anderes begegnen und erscheinen lässt. Etwas, das einen Beginn und einen Abschluss hat. Vom Tartaros kommt sie immer wieder herauf und begegnet dort Nyx, der sich mit ihrer Rückkehr dorthin zurückzieht: An der Grenze des „schwarzen Abgrunds“ (729), „wo Nyx und Hemera sich berühren, tauschend den Gruß, einander begegnend auf eherner großer Schwelle. Da steigt die eine abwärts, aufwärts der andre immer, und nie umschließt sie beide zugleich die Behausung, sondern kaum hat das eine von beiden die Wohnung verlassen, über die Erde zu streifen, so weil das andere drinnen, harrend der Stunde des eigenen Wegs, bis sie wieder herankommt: Hemera, die das weithinschauende Licht den Irdischen spendet, er aber, der in den Händen den Schlaf, den Bruder des Todes, birgt, der verderbliche Nyx, gehüllt in schwärzlichen Nebel.“ (748ff.)
[8] 126f.
[9] 132f.
[10] 150ff.
[11] „Gähnende Leere“, so müsste man wohl Chaos übersetzen. Es ist ein abgrundtiefes Klaffen,
[12] Die Szenerie ist in der Genesis durchaus ähnlich: Nach Erschaffung von „Himmel und Erde“ heisst es, „die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut“. Allerdings schwebt der schöpferische „Geist Gottes über dem Wasser“, der dann „spricht“: „Es werde Licht.“
[13] 157ff.
[14] 137f.
[15] 160ff.
[16] Während Uranos die entäußerten Kräfte in Gaia binden wollte, sucht Kronos sie selbst aufzunehmen und unter seine Ordnung zu stellen.
[17] Zeus wird später Metis verschlingen, um sie ganz in sich aufzunehmen. Metis ist das unausdrückliche Wissen, das alles behauptete und mit Gründen ausgezeichnete Wissen leitet. Zeus vermählt sich mit diesem Wissen und verleibt es sich ein. Die Verständigkeit wird eine „leibliche“ Lebenskraft, die er freilich als Athene wieder verkörpert entläßt, frei-setzt.
[18] Der Grund seines Lebens ist ihm nichts Äußerliches, der sich vom Schmerz trennen ließe. Man versteht den Schmerz nicht, wenn man nicht weiß, was ihn „ausmacht“. Schmerz lässt sich nicht wesenlos und qualitätsfrei quantifizieren. Der Liebesschmerz ist etwas anderes als die Verwundung im Kampf oder die Arbeitsverletzung durch Ungeschicklichkeit oder der Sportunfall. Prometheus Leiden ist seine Existenz und sein Wesen.
[19] W. Schadewaldt, Tübinger Vorlesungen, Bd. 4, S. 29.
[20] Seine Herrschaft verdankt sich ja überhaupt der aktiven Zuwendung Gaias, die ihn vor dem Verschlingen durch Kronos rettet.



