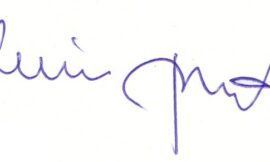Würde ist begriffsgeschichtlich betrachtet etwas, das einer ausgezeichneten, herausragenden Rolle zukommt, staatlichen oder religiösen Amtsträgern wie Königen z.B. oder „hohen“ Priestern. Solche „Ämter“ verleihen Rechte und Pflichten. Würde drückt dann Erwartungen aus, wie man sich in und zu einer hierarchischen Rolle zu verhalten habe. Würdevoll verhält sich, wer in seinem Verhalten der Würde des Amts gerecht wird, das er auszufüllen hat. Würdevoll (und würdelos) können nur „Würdenträger“ sein, die an dem „Amt“ gemessen werden, das ihnen zugesprochen wird.
Roms dignitas
 Wie sich diese Würde begründet sieht man schön an der dignitas römischer Senatoren und Konsuln – und später den Kaisern. An sie waren solche starke Erwartungen an würdevolles Auftreten geknüpft. Den „Grund“ für die mit diesen Amts-Personen[1] verbundene dignitas sieht Cicero wohl zurecht in der römischen Republik selbst: Rom überragt nach römischen Selbstverständnis alle anderen „Reiche“ und diese Auszeichnung verpflichtet ihre „Würdenträger“ auf ein „ausgezeichnetes“ Verhalten. Die Würde des römischen Bürgers gibt ihm Rechte und verbietet zum Beispiel, dass er gefoltert wird, oder – mit wenigen Ausnahmen – die Todesstrafe.
Wie sich diese Würde begründet sieht man schön an der dignitas römischer Senatoren und Konsuln – und später den Kaisern. An sie waren solche starke Erwartungen an würdevolles Auftreten geknüpft. Den „Grund“ für die mit diesen Amts-Personen[1] verbundene dignitas sieht Cicero wohl zurecht in der römischen Republik selbst: Rom überragt nach römischen Selbstverständnis alle anderen „Reiche“ und diese Auszeichnung verpflichtet ihre „Würdenträger“ auf ein „ausgezeichnetes“ Verhalten. Die Würde des römischen Bürgers gibt ihm Rechte und verbietet zum Beispiel, dass er gefoltert wird, oder – mit wenigen Ausnahmen – die Todesstrafe.
Eine Art zu leben
Aus der Würde des Amts wird schließlich – wohl unter christlicher Ägide – die Würde des Menschen als solchem, der sich christlich als gottesebenbildliches Geschöpf versteht und daraus Rechte und Pflichten ableitet.
 Würde ist seither etwas, das dem Menschen qua Mensch zukommt. Er unterscheidet sich damit von Gegenständen und auch Tieren – denen allerdings, wie allem Lebendigen, in anderer Weise ebenfalls eine gewisse Würde zugesprochen werden kann. Würde hat dann den Status „eines Anrechts, auf bestimmte Art und Weise geachtet und behandelt zu werden“.[2] Peter Bieri wählt in seinem Buch „Eine Art zu leben. Über die Vielfalt menschlicher Würde“ (2013) eine andere Perspektive. Er geht nicht diesem „Anrecht“, seiner Begründung und den Folgerungen nach, die für die Rechtsordnung daraus gezogen werden müssen, sondern sieht in der Würde „eine bestimmte Art und Weise, ein menschliches Leben zu leben“.[3] Er nennt sie „ein Muster des Denkens, Erlebens und Tuns“. Das ist keine Formulierung, die mich mitreißt. Aber das soll sie auch nicht. Peter Bieri kann der sprachanalytischen Philosophie zugerechnet werden und darf als ein genauer, ruhiger und unaufgeregter Philosoph gelten. Seine Sache ist nicht die große, tiefsinnige Geste. Er versteht sich eher als jemand, der „dieses Muster begrifflich zu vergegenwärtigen und es gedanklich nachzuzeichnen“ versucht.[4] Wenn Peter Bieri also von „Muster“ spricht, dann dürfen wir davon ausgehen, dass das gut überlegt und der ernsthaften Erwägung allemal wert ist. Anders als ich glaubt Peter Bieri, „keinen Blick auf ein metaphysisches Verständnis der Welt“ zu brauchen, um das, was wir mit Würde meinen, angemessen verstehen zu können. Er setzt auf den „wache(n) und genaue(n) Blick“ auf die „vielfältigen Erfahrungen“, die wir mit Würde bezeichnen. Es geht ihm gar nicht so sehr um den Begriff der Würde, sondern um die Beschreibung von Phänomenen und den begrifflichen Nachvollzug „Erfahrungen“, die wir in dieser „Art zu leben“ machen.
Würde ist seither etwas, das dem Menschen qua Mensch zukommt. Er unterscheidet sich damit von Gegenständen und auch Tieren – denen allerdings, wie allem Lebendigen, in anderer Weise ebenfalls eine gewisse Würde zugesprochen werden kann. Würde hat dann den Status „eines Anrechts, auf bestimmte Art und Weise geachtet und behandelt zu werden“.[2] Peter Bieri wählt in seinem Buch „Eine Art zu leben. Über die Vielfalt menschlicher Würde“ (2013) eine andere Perspektive. Er geht nicht diesem „Anrecht“, seiner Begründung und den Folgerungen nach, die für die Rechtsordnung daraus gezogen werden müssen, sondern sieht in der Würde „eine bestimmte Art und Weise, ein menschliches Leben zu leben“.[3] Er nennt sie „ein Muster des Denkens, Erlebens und Tuns“. Das ist keine Formulierung, die mich mitreißt. Aber das soll sie auch nicht. Peter Bieri kann der sprachanalytischen Philosophie zugerechnet werden und darf als ein genauer, ruhiger und unaufgeregter Philosoph gelten. Seine Sache ist nicht die große, tiefsinnige Geste. Er versteht sich eher als jemand, der „dieses Muster begrifflich zu vergegenwärtigen und es gedanklich nachzuzeichnen“ versucht.[4] Wenn Peter Bieri also von „Muster“ spricht, dann dürfen wir davon ausgehen, dass das gut überlegt und der ernsthaften Erwägung allemal wert ist. Anders als ich glaubt Peter Bieri, „keinen Blick auf ein metaphysisches Verständnis der Welt“ zu brauchen, um das, was wir mit Würde meinen, angemessen verstehen zu können. Er setzt auf den „wache(n) und genaue(n) Blick“ auf die „vielfältigen Erfahrungen“, die wir mit Würde bezeichnen. Es geht ihm gar nicht so sehr um den Begriff der Würde, sondern um die Beschreibung von Phänomenen und den begrifflichen Nachvollzug „Erfahrungen“, die wir in dieser „Art zu leben“ machen.
„Drei Dimensionen“ unterscheidet Peter Bieri um die „Vielfalt menschlicher Würde“ in den Blick zu bekommen: „Wie behandeln mich die anderen? Wie stehe ich zu den anderen? Wie stehe ich zu mir selbst?“[5] Sie sind nicht einfach auf die acht Aspekte der Würde zuzuordnen, denen Peter Bieri in acht Kapiteln nachgeht. „Würde als Selbständigkeit“, die erste und vielleicht grundlegende Hinsicht, die bei Peter Bieri auch den größten Raum einnimmt z.B., umfasst alle drei Dimensionen: meine Selbständigkeit zu wahren, zu pflegen und zu stärken, setzt voraus sie auch durch andere gewährt zu bekommen und sie bei anderen anzuerkennen.
Allen Aspekten sucht sich Peter Bieri in allen drei „Dimensionen“ durch „dichte Beschreibungen“ zu nähern. „Dichte Beschreibungen“ sind ein Konzept, das vom Anthropologen Clifford Geertz in den 70iger Jahren für ethnologische Feldstudien eingeführt wurde. Sie suchen die „objektive“, raum-zeitliche, rein gegenständliche Beschreibung menschlichen Verhaltens um die Sinndimension zu erweitern, die Handelnde mit ihren Handlungen verbinden. Der mit dem Handeln verbundene Sinn ist nur durch „teilnehmende Beobachtung“ zu erschließen: Sinn erfordert den „Nachvollzug“ der Sinnzusammenhänge durch den Beobachter. Der Beobachter muss sich selbst in den Beobachtungsgegenstand einbringen, um den damit verbundenen Sinn in performativer Einstellung zu verstehen. „Würde als Lebensform“ ist nur durch Teilnahme an den Erlebnissen und Verständigungsprozessen zu verstehen, die diese Lebensform ausmachen und gestalten. Peter Bieri würde die „dichten Beschreibungen“ wohl eher literarische oder poetische Zugänge nennen, die das Wirkliche in Geschichten zeigen.
Zwergewerfen
Eine dieser Geschichten beschreibt eine verstörende Erfahrung, die Peter Bieri auf einem Jahrmarkt gemacht hat. Dort gab es einen Wettbewerb des „Zwergen-Weitwurfs“, in dem extrem kleinwüchsige Menschen von den „Spielern“ so weit wie möglich geworfen werden sollten. Die „Kleinwüchsigen“ landeten vergleichsweise weich auf einer Schaumstoffmatte und trugen Gelenkpolster und Helme. Körperliche Verletzungen blieben deshalb aus. Peter Bieri sah darin aber die Würde verletzt. Die Spieler und amüsierten Zuschauer konnten das nicht nachvollziehen. Und auch die lebenden Wurfgegenstände, die „Zwergwüchsigen“ selbst, zeigten ihr Unverständnis. Zwischen 1991 und 1995 kam es dann in Frankreich zu einem hitzig geführten Rechtsstreit über ein Verbot des „Zwergewerfens“. Einer der „Kleinwüchsigen“ klagte schließlich vor dem Human Rights Committee der UNO gegen das Verbot. Sein Argument war, er täte es freiwillig und ein Verbot würde seine Selbstbestimmung und damit seine Würde verletzen. Das Gericht wies die Klage ab. Es blieb beim Verbot des Zwergewerfens – und Peter Bieri verteidigt das ausdrücklich und vehement: Die freie Entscheidung sei zwar eine notwendige, aber keine hinreichende „Bedingung für Würde“. „Die Freiheit der Entscheidung schafft nicht durch sich selbst schon Würde. Es kann sich einer aus Freiheit zu einem Tun entschließen, das trotz der Freiwilligkeit gegen die Würde verstößt. Und deshalb setzte das Gericht der Freiheit eine Grenze. Man könnte sagen: Es nahm jemanden die Freiheit, um seine Würde zu retten.“[6] Wirklich?! Freiheit und Selbstbestimmung finden ihre Grenze an der Freiheit und Selbstbestimmung der anderen. Aber dürfen andere meine Selbstbestimmung bestimmen, ohne selbst davon betroffen zu sein?
„You not go with woman!”
 Peter Bieri erzählt von einer Reise zu einer Buchmesse nach Teheran. Natürlich wusste er (irgendwie), was ihn dort erwartete. Und doch ist er nun geschockt. Im Flugzeug meldet sich kurz vor der Landung der Pilot mit dem Hinweis „an alle Frauen an Bord“, „dass sie ein Kopftuch tragen müssen, wenn sie die Maschine verlassen“.[7] Er wird von einer Frau, der er die Hand geben will, darauf hingewiesen, „dass ein fremder Mann einer Frau die Hand gibt – das [sei] verboten“. Und ein Revolutionswächter herrscht ihn hin, dass er auf der Straße nicht neben einer Frau laufen dürfe: „You not go with woman!“[8] Daraufhin entschließt er sich zur sofortigen Abreise. Dass, ein Staat vorschreibt, wie man sich anzuziehen habe, wen man Grüßen und neben wem man auf der Straße laufen dürfe, das verstößt gegen die Würde des Menschen. Zurück im „westlichen Europa“ tritt wenige Tage später in Frankreich ein Gesetz in Kraft, „das einer Frau das öffentliche Tragen des religiösen Kopftuchs und der Burka verbietet“. Hier setzt der laizistische Staat seine Vorstellung von Würde durch, obgleich viele der betroffenen Frauen, dass aus ihrer Sicht das Tragen des Kopftuches zu ihrer „religiösen Würde“ gehöre.[9]
Peter Bieri erzählt von einer Reise zu einer Buchmesse nach Teheran. Natürlich wusste er (irgendwie), was ihn dort erwartete. Und doch ist er nun geschockt. Im Flugzeug meldet sich kurz vor der Landung der Pilot mit dem Hinweis „an alle Frauen an Bord“, „dass sie ein Kopftuch tragen müssen, wenn sie die Maschine verlassen“.[7] Er wird von einer Frau, der er die Hand geben will, darauf hingewiesen, „dass ein fremder Mann einer Frau die Hand gibt – das [sei] verboten“. Und ein Revolutionswächter herrscht ihn hin, dass er auf der Straße nicht neben einer Frau laufen dürfe: „You not go with woman!“[8] Daraufhin entschließt er sich zur sofortigen Abreise. Dass, ein Staat vorschreibt, wie man sich anzuziehen habe, wen man Grüßen und neben wem man auf der Straße laufen dürfe, das verstößt gegen die Würde des Menschen. Zurück im „westlichen Europa“ tritt wenige Tage später in Frankreich ein Gesetz in Kraft, „das einer Frau das öffentliche Tragen des religiösen Kopftuchs und der Burka verbietet“. Hier setzt der laizistische Staat seine Vorstellung von Würde durch, obgleich viele der betroffenen Frauen, dass aus ihrer Sicht das Tragen des Kopftuches zu ihrer „religiösen Würde“ gehöre.[9]
Bloß „keine Theorie“!

Peter Bieri will keine „Theorie der Würde“ vorstellen: es geht ihm nicht darum, „recht zu haben“.[10] Jedenfalls nicht immer. Beim Zwergenwurf ist er sehr entschieden – beim Kopftuch will er „nur“ etwas zeigen, das uns „die Vielfalt menschlicher Würde“ zu bedenken gibt. „Das Buch ist in der Tonlage des gedanklichen Ausprobierens geschrieben. Nicht beweisen“, will er, „sondern sichtbar und verstehbar machen“.[11] Eine „Vergegenwärtigung von vertrauten Erfahrungen“, die der Leser im Anschluss an selbst Erlebtes mit dem Gelesenen messen kann. Und er wünscht sich einen Leser, der „nicht nur von den Gedanken selbst, sondern auch von der Melodie dieses Nachdenkens mitgenommen und verführt“ wird.[12]
Tatsächlich liegen darin die stärksten Passagen dieses Buchs. Dort wo Bieri „dichte Beschreibungen“ gibt, nimmt das Buch den Leser ins eigene Nach-denken mit. Er gestaltet sie fast als kleine (literarische) Erzählungen, als eindrucksvolle innere Monologe oder besser innere Dialoge. „Denken“, so heißt es bei Platon, „ist das innere Gespräch der Seele mit sich selbst“.[13]
Die „dichtesten“ Passage des Buchs finden sich im letzten Kapitel („Würde als Anerkennung der Endlichkeit“). Dort geht es um würdevolles Sterben. In einem ergreifenden Gespräch zwischen einem Sterbewilligen und seiner Ehefrau und einem mit zwei Ärzten, lässt Bieri die unterschiedlichen Positionen zu Wort kommen und „neigt“ dabei deutlich dazu (zurecht!), die Würde auch darin zu sehen, „dem Leben ein Ende [zu] setzen“. Würde besteht in der „Bereitschaft, Tod und Sterben zu akzeptieren“ und das menschliche Leben nicht auf biologisches Leben zu reduzieren.
Und immer wieder greift Peter Bieri zur Erläuterung auf literarische und filmische Beispiele zurück. Literarische Stücke von Robert Walser und Friedrich Dürrenmatt, Henrik Ibsen und Heinrich Mann, um nur einige zu nennen, werden inspirierend und mit feinem Gespür für den Text ausgelegt. So weiß man als Leser gelegentlich nicht mehr, ob hier jetzt (noch) Dürrenmatt oder (schon) Peter Bieri spricht. Auch wenn sich verblüffende Einsichten nicht immer ergeben, kann Peter Bieri den Blick öffnen oder schärfen.

Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“ begleitet uns durchs ganze Buch. In ihm sieht Peter Bieri das Ringen um die eigene Würde und eine Vielzahl von Verletzungen, der sie ausgesetzt ist. Mir hat das Stück nie viel gesagt. Ich fand es kitschig und ein ideologisches Zerrbild des „american dream“. Peter Bieri macht aber glaubhaft, dass sich Arthur Millers Stück tatsächlich in ausgezeichneter Weise zeigen kann, was es heißt, würdeloser Behandlung ausgeliefert zu sein.
Die Vielfalt des Sowohl-als-auch
Peter Bieris Stärke geht freilich mit Schwächen einher. Vieles bleibt offen – Peter Bieri würde vermutlich zustimmend lächeln – und gelegentlich „widersprüchlich“. Im Kapitel „Würde als moralische Integrität“ „vergegenwärtigt“ Peter Bieri Erfahrungen, die Würde als „moralische Würde“ verstehen lassen. Ein ähnlicher „Grundton“ wird auch im Kapitel „Würde als Wahrhaftigkeit“ angestimmt. In der Auslegung von „Tod eines Handlungsreisenden“ tritt das freilich „etwas“ bei Seite, um nicht zu sagen in den Hintergrund. Willy Loman, der handlungsreisende „Held“ des Stücks von Arthur Miller, wollte sich immer die Freiheit zum Ende lassen und inszeniert seinen Suizid als Unfall und damit als Versicherungsbetrug. Im Zweifel gegen die Moral? „Irgendwie“ gehört freilich der Rechtsverstoß sogar zur würdigen Beendigung seines Lebens! Irgendwie? Nur halt wie? Auch hier würde Peter Bieri wohl lächeln und die Frage an den Leser zurückgeben.
Selbstachtung …
Dort wo wir gespannt auf „dichte Beschreibungen“ sind und auf aufschlussreiche Einsichten hoffen, lässt uns Bieri nicht selten mit allerlei Drum-herum-Schleichen allein. Bei der Selbstachtung z.B. als konstitutiver Teil eines würdevollen Lebens.[14] Würde heißt, „nicht zu allem bereit“ sein. Ja, wie wahr. Aber was können wir dazu sagen? Bieri verkürzt es darauf, sich um „die Stimmigkeit im Leben zu kümmern“.[15] Er hat recht, dass die Grenzen nur von der Person selbst gesetzt werden können.[16] Das Setzen der richtigen Grenze ist freilich eine Kunst, die sich aus dem geführten Leben selbst ergibt, aus unserem Sein-mit-anderen. Unser Leben können wir mehr oder weniger gut führen und die Grenzen können mehr oder weniger richtig gezogen werden. Sich Grenzen setzen resultiert eben aus der mehr oder weniger geglückten Auseinandersetzung mit denen, die uns ihrerseits Grenzen ziehen, dafür Gründe geben, auf die wir mit Gründen antworten. Vermutlich wird Bieri da zustimmen.[17] Darüber wie das gehen könnte und woran wir uns dabei halten können, lässt er freilich offen. Selbstachtung ist dann ein konstitutiver Teil der Würde, wenn sie – z.B. durch eine Gefährdung oder Anfeindung – als etwas erlebt wird, das die Richtigkeit der eigenen Lebensführung und ihrer Werte bewährt. Es gibt kein würdevolles Leben im Falschen und Selbstachtung erfüllt sich in der Achtung vor dem, was wahr und richtig ist.
… und Pflichten gegen sich selbst

In der Tradition wurde hier von Pflichten gegen sich selbst gesprochen: die Verpflichtung seine Fähigkeiten entwickeln zu lassen und zu entwickeln, sein Leben zum Besten führen zu wollen und das Seine zu tun. Es ist freilich umstritten, ob von Pflichten gegen sich selbst überhaupt gesprochen werden sollte. Können wir von Pflichten immer nur gegenüber anderen sprechen, denen wir Rechte zusprechen, aus denen sich Pflichten allererst ableiten? „Wenn das verpflichtende Ich mit dem verpflichteten in einerlei Sinn genommen wird, so ist Pflicht gegen sich selbst ein sich widersprechender Begriff.“[18] Wer sich selbst auf etwas verpflichtet, könnte sich auch selbst nach Belieben davon befreien. Kläger, Beklagter und Richter fielen in eine Person.
Unter „römischer“ Perspektive löst sich dieser Konflikt vergleichsweise einfach: der „Würdenträger“ hat Rechtem mit denen Pflichten einhergehen. Er ist zu würdevollem Verhalten „verpflichtet“, das seinem Amt entspricht. Die Selbstverpflichtung, dem Amt gerecht werden zu wollen, spiegelt die Verpflichtung gegen das imperium Romanum und dem SPQR, dem Senat und dem Volk Roms. Der Würdenträger kann sich nicht mehr Würde geben als ihm sein Amt zuspricht. Er darf dem Amt, das er innehat, seine Würde aber durch „ungebührliches“ Verhalten auch nicht nehmen.
Die Natur und ihre Metaphysik
Kant unterscheidet zwei „Naturen“ innerhalb einer Person, die diese Selbstverpflichtung verständlich machen: „Der Mensch betrachtet sich, in dem Bewusstsein einer Pflicht gegen sich selbst, als Subjekt derselben, in zweifacher Qualität: erstlich als Sinnenwesen, d.i. als Mensch (zu einer Tierart gehörig); dann aber auch als Vernunftwesen…“[19] Die Person verpflichtet sich als „Sinnenwesen“ auf das, was ihr durch ihr Sein als „Vernunftwesen“ aufgegeben ist. Sie verwirklicht ihre Natur als vernünftiges Lebewesen (ζῷον λόγον ἔχον). Sie hat die Würde und Bürde der Autonomie.
Peter Bieri glaubt kein (solches) „metaphysisches Verständnis der Welt“ voraussetzen zu müssen. Er möchte nur von „Muster[n] des Denkens, Erlebens und Tuns“[20] ausgehen. Freilich scheint mir, wenn wir diese „Muster“ verstehen wollen, auf solche „metaphysische“ Voraussetzungen unseres Verstehens stoßen ohne die wir uns selbst nicht recht verstehen könnten. Wenn wir an Peter Bieris Entschiedenheit bei der Beurteilung des Zwergenwurfs erinnern, dann scheint er mir auf solche „Voraussetzungen“ zurückzugreifen. Der „Zwerg“ kann nur gegen seine Würde verstoßen, wenn er sie „an sich“ (oder von Natur) hat. Den mit seinem Leben als autonome Person verbundenen Anforderungen (vergleichbar einem verliehenen Amt) muss er gerecht zu werden versuchen. Der Zwerg sollte nicht, kann aber gegen seine Würde verstoßen. Wir alle tun dies gelegentlich und verhalten uns würdelos. Wir können und sollten uns darüber gegenseitig kritisieren und beraten. Ein Leben in Würde (und Autonomie) zu ermöglichen, dazu können wir uns untereinander unterstützen und bestärken. Das Leben in Würde führen, können wir nur selbst. Wir können es also falsch finden, dass Zwerge sich zur Belustigung durch die Luft werfen lassen. Wir können diejenigen kritisieren, die sich daraus einen Spaß machen. Aber können und sollten wir einen „Zwerg“ zu seinem Glück zu zwingen? Ohne wirklich sicher zu sein, neige ich zu einem vorsichtigen Nein.
Peter Bieris wird „eine Art zu leben“ zur menschlichen überhaupt und damit die Frage der Würde, zur Frage wie wir leben wollen (und sollen). Wie wir leben wollen (und sollen), das ist die Frage von Ethik (und Moral). „Dichte“ Beschreibungen und die Vergegenwärtigung von dem, was uns dabei leitet. helfen uns, das Leben in Würde zu führen und der Würde unserer Natur gerecht zu werden. Hier würde Peter Bieri vermutlich nicht mehr lächeln, sondern besorgt die Stirn kräuseln. Das wäre ihm zu großer „metaphysischer“ Balast. Aber ich fürchte ohne ihn wären auch Bieris Näherungen keine wirklichen Einsichten, sondern nur luftige Melodien.
[1] Tatsächlich ist der Personenbegriff eng damit verbunden, dass wir mehrere (Amts-) Rollen einnehmen können. „Person“ leitet sich vom lateinischen „persona“ her, was zunächst Maske und dann Rolle bedeutet. Theaterstücke haben Personen und die Schauspieler schlüpfen in die entsprechenden Rollen, in dem sie unterschiedliche Masken tragen. Die Rollen stellen an den Schauspieler Anforderungen, z.B. den verliebten Jüngling oder den alten Geizkragen, den adligen Schnösel oder den lebenserfahrenen Bauern richtig darzustellen. Der Schauspieler soll in seiner Rolle „aufgehen“ und ihr ganz entsprechen.
Die etymologische Herleitung vom Verb „personare“, durchklingen oder durchtönen, scheitert zwar, ist aber dennoch naheliegend.
[2] Peter Bieri, Eine Art zu leben, Über die Vielfalt menschlicher Würde, 2013, S. 11.
[3] A.a.O., S. 12.
[4] Auch hier stutze ich wieder, wäre es nicht eher begrifflich zu erfassen und gedanklich zu vergegenwärtigen?
[5] A.a.O., S. 13.
[6] A.a.O., S. 31.
[7] A.a.O., S. 40.
[8] A.a.O., S. 40f.
[9] A.a.O., S. 41.
[10] A.a.O., S. 16.
[11] A.a.O., S. 16
[12] A.a.O., S. 17.
[13] Soph. 263e oder auch Theait. 189e ff.: διάνοια μὲν καὶ λόγος ταὐτόν: πλὴν ὁ μὲν ἐντὸς τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτὴν διάλογος
[14] So das Kapitel 5 „Würde als Selbstachtung“.
[15] A.a.O., S. 242.
[16] Das gilt dann freilich auch für den „Zwerg“, der seine Grenze selbst und autonom setzen möchte. Bei Prostitution ist Peter Bieri im Übrigen deutlich vorsichtiger – hier sei noch eine gewisse Mitwirkung gegeben!?!
[17] Im Abschnitt über „Fließende Selbstbilder“ (246ff.) kommt er kurz auf den sozialen Zusammenhang unserer Selbstbilder zu sprechen, bleibt aber im allgemeinen Hinweis auf „gesellschaftliche Bedingungen“ stecken.
[18] Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, Tugendlehre, I, § 1.
[19] A.a.O., §3.
[20] P. Bierie, a.a.O., s. 12.