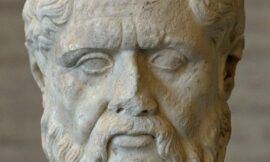MHL
mit Dank für das Geschenk
 Bücher wollen gelesen werden. Sie sollen auch gekauft werden. Der Büchermarkt ist riesig, man kämpft um die Leser. Bücher müssen deshalb geschickt vermarktet werden. Sie brauchen die richtige Aufmachung und einen Titel, der aufmerksam macht. Dabei ist es oft zweitrangig, ob er wirklich genau passt. Was stellen wir uns unter „Papyrus. Die Geschichte der Welt in Büchern“ vor. Das ist der deutsche Titel eines Buchs von Irene Vallejo, das 2019 in Spanien mit dem etwas verrätselten Titel El infinito en un junco erschien, also etwa „Unendlichkeit im Schilf“. Da Papyrus aus einer Pflanze (Echter Papyrus), die an Flussufern und sumpfiger Umgebung wächst, hergestellt wird, das wohl die Brücke zum Schilf. Die aufwändige Herstellung von Papyrusrollen wird bei Irene Vallejo auch beiläufig erläutert. Papyrus war neben dem späteren Pergament und dem erst im 11. Jahrhundert langsam in Europa sich verbreitenden Papier, der Trägerstoff der schriftlichen Kultur. Aber Irene Vallejo geht es weniger um den Trägerstoff als vielmehr – wie der spanischen Untertitel sagt – La invención de los libros en el mundo antiguo, also um die Erfindung des Buchs als kulturelle Institution, die Kultur des Buches und von Gesellschaften, deren Kultur durch das Buch wesentlich (mit-)bestimmt werden. Irene Vallejo liefert also keine „Geschichte der Welt in Büchern“, sondern verfolgt an ausgewählten Beispielen die Wirkung, die die Erfindung des Buchs auf das Selbstverständnis der Gesellschaft von Lesenden hervorgebracht hat.
Bücher wollen gelesen werden. Sie sollen auch gekauft werden. Der Büchermarkt ist riesig, man kämpft um die Leser. Bücher müssen deshalb geschickt vermarktet werden. Sie brauchen die richtige Aufmachung und einen Titel, der aufmerksam macht. Dabei ist es oft zweitrangig, ob er wirklich genau passt. Was stellen wir uns unter „Papyrus. Die Geschichte der Welt in Büchern“ vor. Das ist der deutsche Titel eines Buchs von Irene Vallejo, das 2019 in Spanien mit dem etwas verrätselten Titel El infinito en un junco erschien, also etwa „Unendlichkeit im Schilf“. Da Papyrus aus einer Pflanze (Echter Papyrus), die an Flussufern und sumpfiger Umgebung wächst, hergestellt wird, das wohl die Brücke zum Schilf. Die aufwändige Herstellung von Papyrusrollen wird bei Irene Vallejo auch beiläufig erläutert. Papyrus war neben dem späteren Pergament und dem erst im 11. Jahrhundert langsam in Europa sich verbreitenden Papier, der Trägerstoff der schriftlichen Kultur. Aber Irene Vallejo geht es weniger um den Trägerstoff als vielmehr – wie der spanischen Untertitel sagt – La invención de los libros en el mundo antiguo, also um die Erfindung des Buchs als kulturelle Institution, die Kultur des Buches und von Gesellschaften, deren Kultur durch das Buch wesentlich (mit-)bestimmt werden. Irene Vallejo liefert also keine „Geschichte der Welt in Büchern“, sondern verfolgt an ausgewählten Beispielen die Wirkung, die die Erfindung des Buchs auf das Selbstverständnis der Gesellschaft von Lesenden hervorgebracht hat.
Viel besser als eine Geschichte des Buchs

Vermutlich hat der Verlag bessere Vermarktungschancen gesehen, wenn durch nebulöser Überblendung von der „Geschichte der Welt“ und der „Geschichte des Buchs“ gleich zwei Lesergruppen angesprochen werden: Der Klappentext nämlich behauptet, Papyrus erzähle „die Geschichte des Buches, eines Artefakts, die Menschheit sei fas fünftausend Jahren fasziniert und das es in den unterschiedlichsten Formen gegeben hat: aus rauch, Stein, Ton, Schilf, Seide, Leder, Holz und neu auch aus Kunststoff und Licht“. Aber: das Buch von Irene Vallejo ist viel besser als eine „Geschichte des Buchs“ sein kann, das in Form und dann und dann und dann vorgeht. Irene Vallejo, studierte Altphilologie – was ja wörtlich Liebhaberin der alten Logoi, nämlich der in den antiken Texten überlieferten „Gedanken“, versucht aus der „Erfindung des Buchs in der antiken Welt“ Einsichten zu gewinnen, die auch uns heutige Leser angehen.
Von Alexander, dem Großen, weiß man, dass er sich an Achill ein Vorbild nahm. Bei seinem sagenumwobenen Feldzug durch Kleinasien, Ägypten und dem Persischen Reich führte er stets die Homersche Ilias als „Brevier“ zur seelischen Erquickung und geistigen Erbauung mit. Das Buch war der Begleiter, an dem er Ausrichtung und Stütze fand. Als nach seinem Tod das Riesenreich in Teile zerbrach, entstand in der von ihm gegründeten Stadt Alexandria als Teil des Herrscher-Palastes eine der größten Bibliotheken der Antike. Ptolemaios entsandt in alle Teile der damaligen Welt Einkäufer, um den ganzen Reichtum des damaligen Schrifttums nach Alexandria zu holen: der geistige Reichtum der Welt sollte in Alexandria und damit unter der Herrschaft Ptolemaios versammelt werden. Mit großzügigem königlichen Sponsoring zog man Gelehrte aus aller Welt an den alexandrinischen Hof, um die Schriftrollen zu kopieren, zu bewerten und Lücken in der Sammlung auszumerzen.

Mit Irene Vallejo springen wir dann knapp zweitausend Jahre in unsere Gegenwart und gut viertausend Kilometer nordwestlich zu ihrem ersten Aufenthalt in Oxford. „Schnurstracks“ eilt sie zur berühmten Bodlein Library. Allerdings wird ihr der Eintritt verwehrt. Sie musste sich erst eines umfangreichen Bewerbungsverfahrens unterziehen inclusive eines Schwurs, die Gebote der Bibliothek einzuhalten, „kein Buch zu entwenden, zu beschädigen oder zu verunstalten“ und in der Bibliothek weder ein Feuer anzuzünden noch dabei behilflich zu sein. Erst danach wurde ihr Zugang gewehrt. Ausleihen durfte sie freilich nicht. Sie konnte Bücher zur Lektüre im Lesesaal bestellen und bekam dann nach einigen Tagen die Nachricht, dass in einem bestimmten Lesesaal die bestellten Bücher hinterlegt seien. Das verblüffende Prozedere verdankt sich nicht einer aufgeblähten Bürokratie oder heilloser Unterbesetzung – sie resultiert aus der schlichten Masse der zu verwaltenden Bücher. Jeden Tag – so kann man bei Irene Vallejo lesen – gehen etwa 1.000 neue Bücher bei der Bodlein Library ein, 100.000 im Jahr und rund 200.000 Zeitschriften. Das bedeutet einen jährlichen Bedarf von ca. drei Regalkilometer für deren Aufbewahrung. Im Oxforder Untergrund findet sich ein Netz von Bibliotheksgängen, die mit Transportbändern verbunden sind und in denen Bibliothekare gleich Bergarbeitern die geistigen Schätze einlagern und wieder herauffördern. Wer nach der Lektüre von Papyrus durch die Altstadt kleiner, traditionsreicher Universitätsstädte wie Oxford oder Cambridge streift, kann nun unter seinen Füssen auch den Reichtum einer langen Buchtradition erahnen, über die er hinweggeht.

In Deutschland haben wir in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt nur rund 41 Millionen Bände und in der Bayrischen Staatsbibliothek rund 34 Millionen versammelt, wogegen die Britisch Library oder die Library of Congress dem geneigten Leser rund 170 Millionen Bücher zur Lektüre anbieten.

Mit der damals größten Bibliothek in Alexandrien, man schätzt sie bestand aus vierzig bis fünfzigtausend Papyrusrollen, teilen die modernen Bibliotheken das Problem der Erhaltung ihrer Schätze. Während man den heutigen Mengen nur mehr elektronisch beizukommen scheint, waren die antiken Schätze durch Zersetzung und Fraß bedroht. Eine Rolle aus Papyros hatte eine „Lebensdauer“ von maximal 200 Jahren.[1] Was man erhalten wollte, dass musste also ständig abgeschrieben werden. Welches Buch, lieber Leser, wäre Ihnen so wichtig, dass sie es abschreiben würden, um es für sich und die Nachwelt zu erhalten? – von den enormen Kosten von der Bereitstellung des kostbaren Schreibmaterials mal ganz zu schweigen. Gibt es kein solches Buch? Dass wir Homers Ilias, Platons Phaidon oder Aristoteles Nicomachische Ethik heute noch lesen können, verdankt sich Lesern und Sammlern, die sie für uns in ständiger Erneuerung erhielten. Hätten sie ja nicht tun müssen, meinen Sie? Schon wahr, aber auch sehr traurig. Für die Christen war das keine Frage, die Bibel, wörtlich (βιβλία) das Buch der Bücher, wurde durch ständige Lektüre (und Kopie) erhalten. Irene Vallejo, die das Buch feiert und in ihm ein oder das Zeichen des Humanen, der geistigen Freiheit, erkennen will, verkennt vielleicht, welche gleichgültige Ignoranz ihm heute entgegensteht. Bücher sind nichts mehr wert, sie sind allenfalls billige Unterhaltung oder – manchmal noch – notwendiges Übel zur Erlangung eines Ausbildungs- und Karrieregrads. Meist wird auch das elektronisch ersetzt: wir goggeln mal, geht schneller.
Aber auch elektronisch könnte vieles untergehen. Was auf den ersten elektronischen Speichermedien gesichert wurde, ist heute kaum mehr lesbar. Auch hier muss beständiges Kopieren erfolgen, geistloses Update von einer Technologie auf die nächste. Big Data. Wir speichern erstmal. Auch was uns jetzt uninteressant und überflüssig scheint, kann ja noch geschäftlich relevant werden.
Das auf Papier gedruckte Buch erweist sich auch gegen die elektronische Konkurrenz, die wie ihr Vorläufer aus Papyrus recht anfällig für den Untergang ist, als vergleichsweise stabil. Wir können in ihnen noch blättern wie vor achthundert Jahren.[2] Sie sind noch da, aber weitgehend bedeutungslos. Das will – vermute ich – Irene Vallejo nicht so sehen. Ihr Name ist Programm: Irene leitet sich – das weiß sie besser als ich – von dem altgriechischen εἰρήνη für Frieden her, und meint so viel wie die Friedliche. Sie findet ihren Frieden in den Büchern und gegen eine Welt, die Bücher „eigentlich“ nicht mehr braucht. Welche Bedeutung sollte heute noch – na sagen wir Homers Ilias haben? Wie sehen Sie das, lieber Leser, liebe Leserin? Wie weit liegt ihre Lektüre – oder auch nur ihr ernsthafter Lektüre-Willen zurück? Man hat halt immer was Besseres vor – nicht andere Bücher zu lesen, nein, was wirklich Besseres! Das ist ja auch nicht schlimm – nur eben Teil der Wahrheit.
Homer – wer soll das sein?
Machen wir einen kleinen Umweg, der sich auch bei Irene Vallejo findet: Es wird vermutet, dass die mündlich über Rhapsoden tradierten Geschichten, nachträglich verschriftlicht und der Text nun Homer als Autor zugeordnet wurde. Bei der Odyssee ist die Erzähllogik so kunstvoll, dass man davon ausging, hier müsse ein Künstler die Teile zu einem Ganzen komponiert haben. Aber Fragen der Urheberschaft sind dem Mythos unangemessen. Geschichten gewannen ihre Form dadurch, dass sie immer wieder und wieder vorgetragen, situativ abgewandelt und in die dramatisch wirksame Reihenfolge gebracht wurden. Hinter der epischen Erzählung steht eine Tradition von Erzählern, von denen keiner auf die Idee gekommen wäre, dass es seine Geschichte ist, für die er Autorschaft oder gar ein Urheberrecht reklamieren könnte. Das hätte sie vielmehr verdächtig und „unwirklich“ gemacht. Ihre Wahrheit besteht eben darin, dass sie nicht (nur) einem „Dichter“ zu verdanken sind, sondern dem Be-wahren einer bewährten Tradition.[3] Mit der Schriftlichkeit, dem Niederschreiben eines Textes, wird nun die Autorschaft relevant. Wer freilich darauf beharrt, dass er selbst gesprochen habe – und nicht die Musen (und die Tradition) durch ihn –, der macht sich unglaubwürdig. Er könnte gleich sagen, nehmt’s nicht so ernst, es ist nur von mir. Warum also sollten wir Homer oder Platon, Descartes oder Kant, Shakespeare oder Joyce lesen? Na ja, Shakespeare schon, also nicht lesen, sondern im Theater angucken, weil der ist echt witzig – also zum Teil, na ja … und natürlich schon etwas weniger packend als Netflix, aber als Abwechslung… Seien wir ehrlich, er ist uns egal. Wir würden ihn wohl nicht abschreiben – auch nicht während wir in der Schlange auf das neue iPhone warten.

Aber nun gibt es ja immer noch große Bucherfolge. Harry Potter z.B. oder die Unendliche Geschichte. Und natürlich die Bibel (2,5 Milliarden mal verkauft) und die Mao-Bibel (1,5 Milliarden) vor dem Koran (1 Milliarde). Und das Kommunistische Manifest – eine tolle, „richtungsweisende“ Schrift, dem ich viele Leser wünsche, das aber vermutlich nur durch staatliche Protektion – oder sollen wir Propaganda sagen? – zu diesen zweifelhaften Ehren eines vielgedruckten Buches gekommen ist.
Und die Leser? Das Lesen und Schreiben gilt als Zivilisationsgewinn. Ich will das nicht bestreiten – um Himmels Willen. Aber wer es nicht kann – ist der zurückgeblieben, einfach dümmer? Jahrtausende lang lebten Menschen ohne Schrift: sie bestellten ihre Felder, kümmerten sich um ihre Kinder und ihre Alten und um die Götter, von denen sie wussten. Dann kam die Schrift und sie galten als dumm. Nehmen wir den Analphabetismus – er ist ein Makel nur für eine Gemeinschaft, die durch die Schrift beherrscht wird. Noch heute empfinden Leute Scham, weil sie nicht (gut) lesen und (richtig) schreiben können. Woher rührt diese Scham? Müssen wir uns für etwas schämen, was wir nicht können können – oder gar weil es uns vorenthalten wurde?
Die Scham des Analphabetismus
Warum sollte man sich schämen, nicht lesen oder schreiben zu können? Der Fortschritt liegt darin, dass sie es jetzt könnten, wenn sie wollten und es also an ihnen liegt, sich das Vermögen zu erwerben und es zu nutzen. Scham richtet sich auf das eigene Tun und dem Ausgeliefertsein an das Urteil anderer.[4] Scham müssten doch eher diejenigen empfinden, die es können, aber nicht tun und diese Fertigkeit verkommen lassen, indem sie stattdessen glotzen oder twittern. Natürlich lesen wir heute täglich. Kein Einkauf und kaum eine alltägliche Beschäftigung geht ohne die Entzifferung von Texten. Jeder behördliche Akt ist mit einer Flut von Buchstaben verbunden, die wir rezipieren oder produzieren müssen. Und wer nie ein Buch in die Hand nimmt, keine Zeitung liest oder Tagebuch schreibt, der kommt dennoch beim Surfen oder Netflixen kaum ums Lesen und Schreiben herum. Jahrhunderte konnten Menschen ihr Leben ohne Lesen und Schreiben führen und Millionen tun es noch heute; schwierig wird es für sie vor allem dann, wenn die Schreiberlinge ihr Leben zu bestimmen vermögen. Wer alles verschriftlicht, der macht diejenigen, die nicht Lesen können, zu Behinderten.
Geistloser Text
Die Schrift nimmt uns auch in anderer Weise gefangen. Platon sah in der Verschriftlichung des philosophischen Gesprächs eine Gefahr – die Texte bleiben sich selbst überlassen. Irene Vallejo spricht davon, das Editieren von edere, hinausgeben, abgeleitet ist und so viel sagt, wie ein Werk seinem Schicksal zu überlassen. Die mündliche Überlieferung dagegen lebte von der persönlichen Begegnung. Der Erzähler sah die Reaktion des Publikums, konnte nachsteuern und verstehen, dass er sich selbst missverständlich ausdrückte. Die Hörer hörten zu, reagierten, litten mit und erlagen mehr oder weniger dem Pathos. Die schriftliche Form zwang zum Lesen und das hieß zum Nachsprechen. Lesen hieß laut Lesen. „In frühen Grabinschriften baten Tote die Vorübergehenden, ihnen ihre Stimme zu leihen, um zu erwachen und kundzutun, wer im Grabe lag. Die Griechen und Römer glaubten, dass sich jeder geschriebene Test eine lebendige Stimme aneignen müsse, um Vollkommenheit zu erreichen.“ Der Leser, der den Text wirklich (verstehend) liest, wird vom Text ergriffen und es erfolgt „eine Art geistige und stimmliche Inbesitznahme“, er wird „vom Atem des Schreibers ergriffen“[5]. Augustinus beschreibt in den Confessiones seine Irritation als er seinen Lehrer Ambrosius von Mailand regungslos in ein Buch starren sah. Er glaubte ihn „verrückt“. Er konnte nicht verstehen, dass er (still) las, denn lesen hieß sprechen, aussprechen, dem Rhythmus des Textes folgend und ihm seinen Rhythmus gebend.
Wenn wir heute an Bibliotheken denken, dann denken wir an Lesesäle, in denen vor allem eins herrscht: Stille. Wir gehen deshalb mit einer anachronistischen Erwartung auf die Suche nach den großen antiken Bibliotheken von Alexandria und Pergamon. Wir haben von antiken Quellen (insbesondere von Strabon) vergleichsweise gute Beschreibungen des Palasts von Alexandria, aber nirgends findet sich eine Beschreibung der berühmten Bibliothek. Es ist zu vermuten, dass die Papyrusrollen in Nischen der Säle und Gänge gelagert waren, die man – vermutlich über Bibliothekare – die gewünschten Rollen aushändigen ließ und mit ihnen sich einen Platz im verzweigten Palast gesucht hat, an dem man halblaut die Texte deklamierte oder gar sang.
Identifiziert wurden die gesuchten Rollen über kurze prosaische Titel, die auf das Äußere der Rolle notiert wurde oder – wie wir das heute noch von päpstlichen Enzykliken kennen über die erste sinnstiftende Wörterfolge: so die „benediktische“ Deus caritas est (2006), Redemptor Hominis (1979) oder die vieldiskutierte Humanae vitae (1968). So wird der babylonische Schöpfungsmythos Enūma eliš genannt, nach den ersten beiden Wörtern. Wer eine Papyros-Rolle aufrollt, der findet kein Inhaltsverzeichnis, das ihm durch Seitenangabe durch den Text leitet. Er liest die ersten Zeilen, die ihm etwas über das Werk sagen müssen. In nova fert animus mutatas dicere formas / corpora heißt es am Anfang der Ovidschen Metamorphosen und gibt das Programm des gesamten Werks: alles wird neu ge- und verwandelt, nichts bleibt so wie es scheint, alles wird anders als es ist. Der platonische Phaidon, eines der Meisterwerke Platons und damit der gesamten Philosophie, beginnt mit αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου, „Selbst, oh Phaidon, warst du dabei…“.
In alten Tagen des Buches war der Titel weit weniger entscheidend für die Auswahl der Lektüre. Man hatte nichts zu verkaufen. In alten Tagen des Buches, in der Antike z.B., konnte man als Autor nichts daran verdienen. Man schrieb für Freunde und Bekannte oder solche, die es werden sollten. Wer überhaupt Lesen und Schreiben konnte, der gehörte bis ins zweite vorchristliche Jahrhundert hinein eh zur Oberschicht. Platon z.B. gehörte eine der reichen Familien an, die die attische Herrschaftsschicht ausmachte. Wenn Platon schrieb, dann nicht für Geld. Die Herstellung der Bücher war aufwändig: wer ein Buch haben wollte, der musste es abschreiben (lassen). Man kam auf die eine oder andere Weise für die Herstellung auf – nicht selten waren es vor allem in Rom Sklaven, die bei der Kopie und insbesondere auch bei der arbeitsintensiven Gewinnung der Papyrusrollen selbst herangezogen wurden. Der Autor selbst blieb dabei ein Schenkender, der Freunden etwas sagen und bei ihnen Gehör finden wollte. Es war Ehre genug, dass jemand ein kopiertes Werk erwerben oder die Kopie veranlassen wollte.
Das Spielen mit dem richtigen Titel, „El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo“ oder doch lieber „Papyrus. Die Geschichte der Welt in Büchern“, ist selbst ein Indiz für den Verfall der Buchkultur und ihres Untergangs. Irene Vallejo hat ein schönes Buch über die Welt des Buches geschrieben, das viel Wissenswertes liefert und die Antike als Inspiration für die Gegenwart nutzt. Aber anders als sie bin ich skeptisch, ob die Liebe zum Buch und der Weisheit derer, die uns die besten hinterließen, eine Zukunft hat – nur weil wir es uns wünschen, wird es nicht wahr. Nie wurde täglich so viel gelesen wie heute – zwangsweise. Aber selten glaubte man so wenig an das, was Bücher uns sagen. Das Buch ist gleichsam ein Anachronismus – je mehr wir auf den Markt werfen, desto weniger glauben wir an ihre Kraft.
„Im Anfang…“
Fragen wir unsere Zeit nach guten Büchern, also nach solchen, die für unser Leben wichtig und richtungsweisend sind, dann werden wir vermutlich viel irritiertes Achselzucken ernten. Fast zweitausend Jahre galt wohl zumindest ein Buch als lebensbestimmende Kraft: die Bibel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das selbst für Christen heute noch in gleichem Maße gilt. Es ist ein Buch unter Büchern mit Autoren, die ihre Interessen hatten und halt auch nur Menschen waren.
„Im Anfang war das Wort …“ und das erste Wort war der Groll: Μῆνιν ἄειδε, θεά, „Groll singe, Göttin“, nämlich des „Peleussohns Achilleus“. So beginnt die Ilias des Homer (in der neuen, eigenwilligen Übersetzung von Raoul Schrott): „von der bitternis sing, göttin – von achilleus, dem sohn des peleus/ seinem verfluchten groll, der den griechen unsägliches leid brachte / und die seelen zahlloser krieger hinab in das haus des hades sandte / die blutvollen leben dann nur noch fleisch an dem die hunde fraßen / den vögeln ein festmahl – und wie zeus’ wille sich dadurch erfüllte … / sing muse, und beginn mit dem moment wo der göttliche achilleus / sich in einem streit mit seinem kriegsherrn agamenon entzweite.“ Groll, Zorn, Bitternis – das ist das erste Wort der europäischen Kultur, das war das Wort des Anfangs aus dem sich all die anderen Geschichten verschriftlichten. Sie sind aus der Zeit gefallen und gehören nur mehr denen, die sich noch in Bücher verirren – wie Irena Vallejo und ein paar andere.
[1] In gewissem Sinne war Papyrus tatsächlich „lebendiges“ Material – jedenfalls als Nahrung bei allerlei Tierchen sehr geschätzt. Als Bio-Material war es der Zersetzung ausgeliefert. In Ägypten, in dem der Echte Papyrus wuchs und die aufwändige Verarbeitung zu Papyros-Rollen standfand, herrschten vergleichsweise günstige, heiße Klimabedingungen. Je feuchter und wechselhafter das Klima war, desto anfälliger waren die Schätze.
[2] Auch Pergament ist stabil. Allerdings in der Produktion sehr anfällig. Immer wieder reißen die dünnen Häute auseinander. Die Kopisten haben dann versucht, den Rissen und Löchern selbst Sinn zu geben, z.B. als Ausblick auf die neue Seite – im Loch der einen Seite erscheint dann ein Bild der Folgeseite.
[3] I. Vallejo, a.a.O., S. 144.
[4] Scham betrifft nicht nur die eigene Tat-Schuld, sie ist auch das Eingeständnis in einer Verstrickung zu sein. Man ist jemand, der man nicht sein will, obwohl es daraus kein Entrinnen gibt. Wir schämen uns der Nacktheit der eigenen Existenz und die Schuld liegt bei denen, die einen nackt sein lassen.
[5] I. Vallejo, a.a.O., S. 454f.