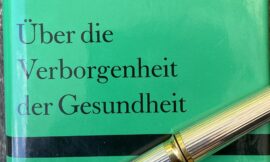Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληιάδεω Ἀχιλῆος – so beginnt Homers Ilias und damit die Geschichte der abendländischen Kultur: „Den Zorn singe, Göttin, des Peleus-Sohns Achilleus, / Den verderblichen, der zehntausend Schmerzen über die Achaier brachte / Und viele kraftvolle Seelen dem Hades vorwarf / … / Von da beginnend, wo sich zuerst im Streit entzweiten / Der Atreus-Sohn, der Herr der Männer, und der göttliche Achilleus.“ (Text)
Zehn Jahre waren bereits vergangen seit die Griechen gegen Troja aufgebrochen waren, zehn Jahre verzweifelter Kampf, Belagerung, kriegerische Fort- und Rückschritte. Schnellen Sieg und reiche Beute hatte Agamemnon („der Atreus-Sohn“ und „der Herr der Männer“) den Griechen versprochen. Wenig ist davon eingetroffen. Nach wie vor hält Troja stand, die Griechen befinden sich fern der Heimat an unwirtlichen kleinasiatischen Stränden in der Belagerung. Jetzt setzte auch noch die Pest ein. Apollon hatte sie über das griechische Heer geschleudert, nachdem sich Agamemnon geweigert hatte, eine Kriegsbeute auszulösen, die Tochter eines Apollon-Priesters. Nun muss er sie widerwillig doch freigeben. Seine Ehre fordert freilich Ersatz. Heerführer und König zu sein gründet in Stärke, die immer neu bewiesen werden muss. „Agamemnon, der sich jetzt der weit Beste zu sein rühmt“ (I, 90f.), ist freilich nur bedingt der Stärkste – er wird von Achill durch Heldenmut, Kampfeswillen und Stärke weit übertroffen.
Agamemnons Stärke resultiert aus der Anerkennung der anderen Fürsten und die ist nun in Gefahr. Agamemnon muss, will er seine Herrschaft und seine Ehre wahren, sich Achill stellen und ihn herausfordern – obwohl er Achills Überlegenheit kennt. Er fordert Achills Kriegsbeute als Ersatz für die eigene, die er zur Rettung des griechischen Heeres abgeben muss.
Die Lage ist aufs Äußerste gespannt. Achill schäumt vor Wut. Er greift zum Schwert und ist drauf und dran Agamemnon vor den Augen aller in Stücken zu hauen. Die anderen Griechenfürsten hätten das wohl respektiert und Achill als neuem Heerführer anerkannt. Doch Achill hält inne: „Während er solches bei sich beriet in der Tiefe des Herzens / Und das gewaltige Schwert schon zückte, da nahte Athene / Fern vom Himmel“ (I, 193ff) Nur ihm ist sie sichtbar. Achill erschrickt: „Tochter des wetterleuchtenden Zeus, was bist Du gekommen?“ (I, 202) Athene fordert ihn auf vom Streit abzulassen und das Schwert in die Scheide zurückzustecken. Achill folgt: „Euer Wort, o Göttin, geziemt es wohl zu bewahren, / Welche Wut auch im Herzen sich hebt; denn solches ist besser. / Wer dem Gebote der Götter gehorcht, den hören sie wieder.“ (I, 216ff)
Von solcher Art ist jedes Argument. Es vermag den Sinn zu wenden und gegen den ersten Widerstand sich auf Grundlegendes zurückzubesinnen. Es ist die Wiedergewinnung des Selbstverständlichen, das einen wie etwas Erhabenes überkommt. Das Selbstverständliche ist nichts Selbstgemachtes, nichts Ausgedachtes und berechnend Konstruiertes. „Solang du Selbstgeworfnes fängst ist alles / Geschicklichkeit und läßlicher Gewinn“ (Rilke). Es ist etwas, das wir er-fahren und das uns gleich Achill erstaunt und durchaus schmerzlich widerfährt. „Nah ist und schwer zu fassen“ wie Hölderlin sagt nicht nur „der Gott“. Das Ureigenste, das Selbstverständliche, muss erst gehoben und im Widerstand gegen Anderes verstanden werden. Es widerfährt uns, indem wir gleich Achill innehalten, das Handeln einen Moment aussetzen und uns besinnen. Dann erscheint sie: Athene. Jürgen Habermas hat vom „zwanglosen Zwang des besseren Arguments“ gesprochen. Es ist Epiphanie, das Erscheinen von Athene. Ihre Wahrnehmung ist für Achill zugleich Anerkennung und Selbstermächtigung. Die Anerkennung Athenes, die Wahrnehmung des Selbstverständlichen, ist Selbstverwirklichung. Am Anfang der abendländischen Kultur wird uns gesagt: Es gibt kein wahrhaft gutes Argument ohne Erscheinen der Götter.
Die Links dieser Seite wurden zuletzt am 22.04.2019 überprüft.
© 2019 Heinrich Leitner | Bildnachweise